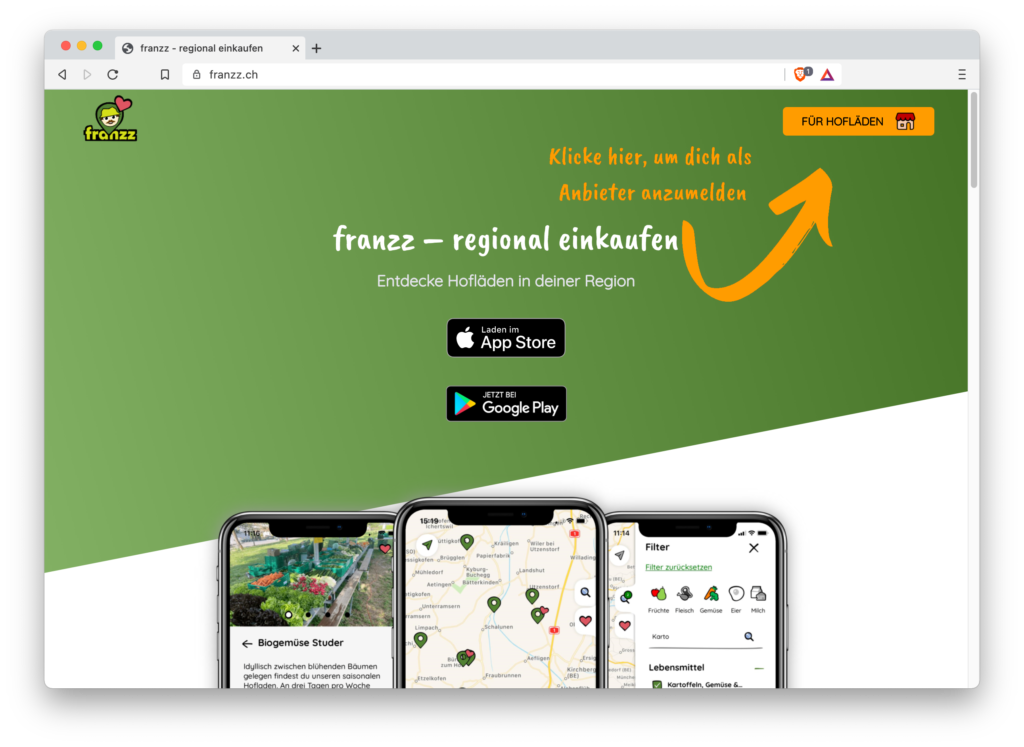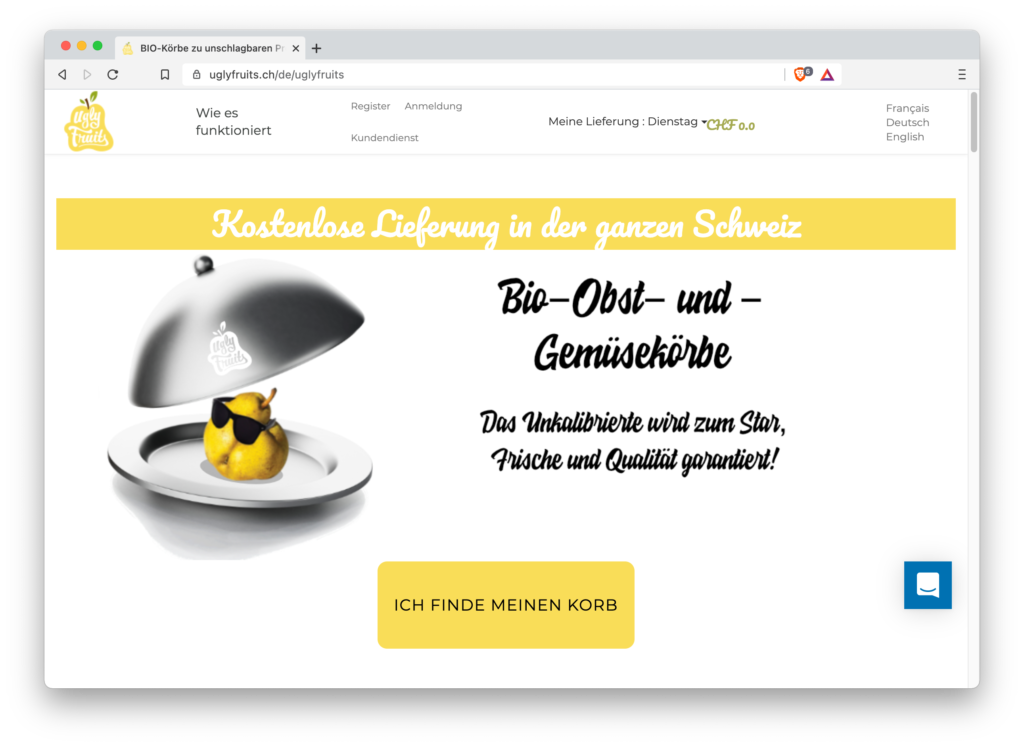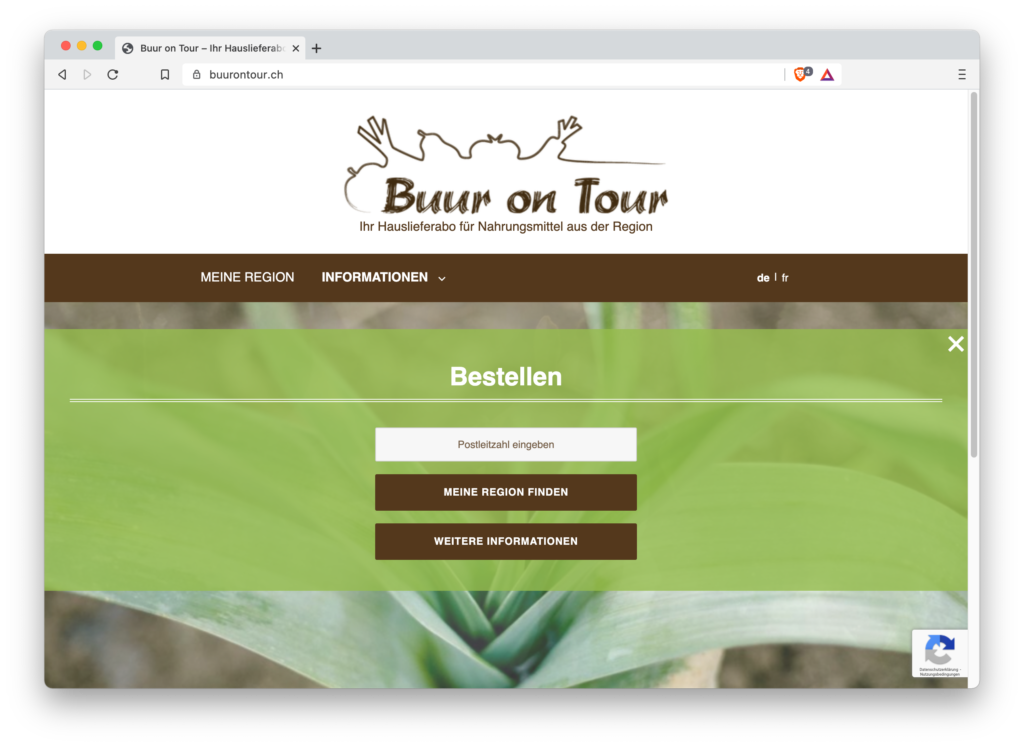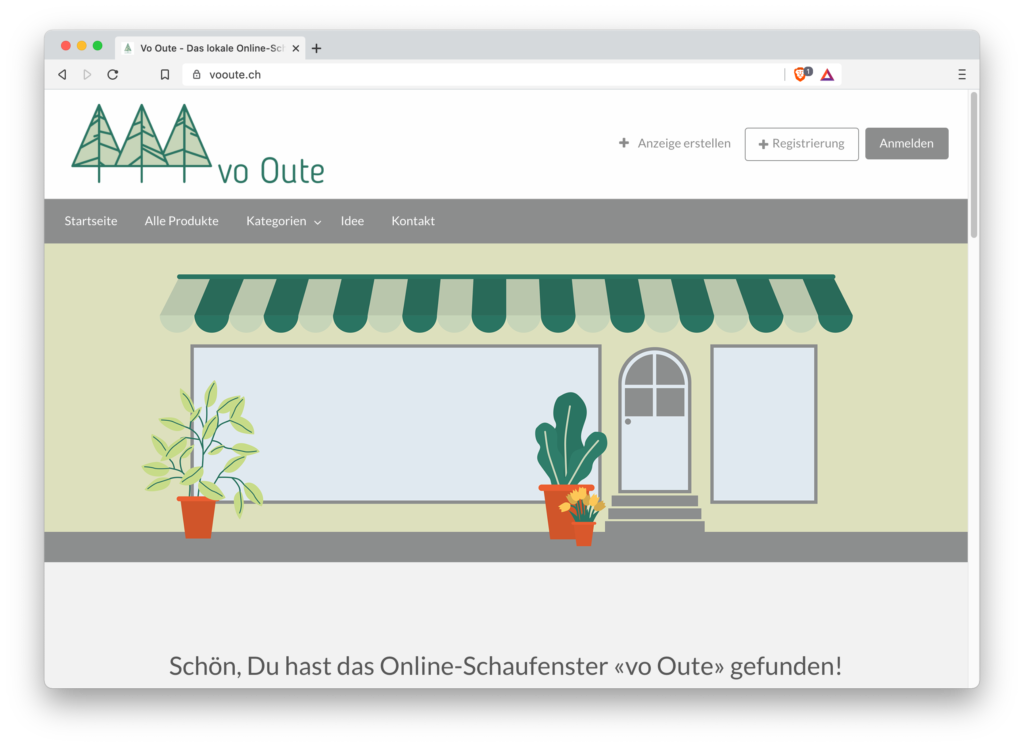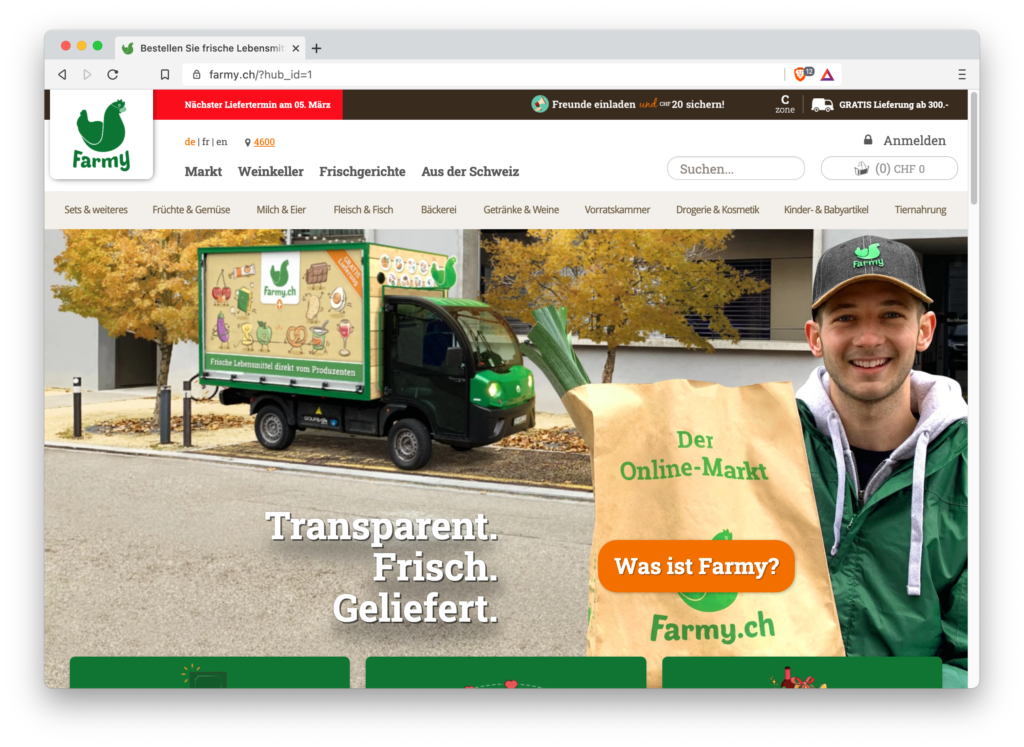«Viele sind gehemmt, weil sie denken, bei uns nur ungewaschenes Zeugs zu kriegen»
Jedes Stück ist ein Unikat. Jedes hat seine eigene Geschichte. Viele bleiben verborgen. Einige erzählen die Menschen, die sich im Hinterhof von einem gebrauchten Kleidungsstück lösen. Da ist der Mantel, den eine ältere Frau in den Laden brachte. Innen ist er mit «Création Olten» angeschrieben. Ihre Urgrossmutter hatte ihn gekauft. Nun hat sie ihn auf die Reise gegeben. Ihn der Familie von Regina Graber (49) anvertraut.
Ihre Söhne Yannic (28) und Léon Aeschbacher (26) kennen ein paar Geschichten zu den Kleidern, die in ihrem neuen Laden hängen. Klein, aber fein kuratiert auf drei Etagen. Das verwinkelte Lokal im unscheinbaren Hinterhof könnte besser zum Ladenkonzept nicht passen. Die Spuren des ursprünglich angesiedelten Elektrofachgeschäfts sind geblieben und verleihen dem Lokal einen industriellen Charme. Da steht zum Beispiel ein Massivholzgestell, in dem früher Elektro-Ersatzteile verstaut gewesen sein müssen. Heute sind darin gebrauchte Turnschuhe und Birkenstocks zur Schau gestellt.

Wie ein kleines Museum
Im Untergeschoss hängen Fussballtrikots aus früheren Tagen, zeugen von einer Zeit, in der der Kommerz den populärsten Sport der Welt noch nicht komplett vereinnahmt hatte. Die Leibchen schlicht, die Werbung ebenso. Yannic schwärmt. «Gestern hab ich ein 25-jähriges Trikot von Paris verkauft.» Für Liebhaberstücke muss die Käuferin im Hinterhof etwas mehr Geld hinlegen. Aber weniger als auf den gängigen Online-Verkaufsportalen.
Aber Yannic sagt: «Wir haben hier für alle etwas. Auch jene, die weniger Geld haben, sollen bei uns Klamotten zu einem fairen Preis kriegen.» Neulich habe er drei Winterjacken an Flüchtlinge verschenkt, die noch immer in Jeansjacken unterwegs waren, erzählt er. Das Aus des Caritas-Ladens riss eine Lücke für Menschen mit weniger Ressourcen. Dies habe sie bestärkt, ihre Ladenidee in die Stadt zu bringen. Secondhand in einem Lokal, das ist die Antithese zum Onlinekaufwahn, zum Päckliboom, zur Generation Zalando. Anders als viele junge Menschen haben sich die beiden Brüder nie vom Konsumhype anstecken lassen. In einem Elternhaus aufgewachsen, in dem vieles selbst repariert oder umgestaltet wurde, hat ihre Sicht auf den Konsum geprägt. «Wir kauften immer schon secondhand ein», sagt Yannic. Im Laden bietet der Hinterhof zudem einen Reparaturdienst für Textilien und andere Materialien an.

Secondhand soll sexy sein
Was in grösseren Schweizer Städten und gerade auch in anderen Ländern schon länger ein Geschäftsmodell ist, gab’s in Olten in dieser Form noch nicht. Die vielen Brockenstuben sind mehrheitlich dezentral und präsentieren die Kleidungsstücke nicht, wie der Hinterhof dies tut. Andere Secondhand-Läden deckten eher ein anderes Segment ab und sind mittlerweile wieder verschwunden. Diese Lücke will die Familie Graber Aeschbacher füllen. «Obwohl ich glaube, dass die Menschen hier zusehends ökologisch eingestellt sind», sagt Yannic. Um Kundschaft anzulocken, will das Hinterhof-Team den verstaubten Ruf der Secondhand-Ware aufpolieren. Zeigen, dass gebrauchte Kleidungsstücke auch sexy sein können. Zuhause waschen sie jedes Kleidungsstück, das ihnen gespendet wurde oder sie zugekauft haben. Yannic weiss: «Viele, die noch nie in einem Secondhandladen waren, sind gehemmt, weil sie denken, bei uns nur ungewaschenes Zeugs zu kriegen.»

Ein bis drei Personen liefern pro Tag im Hinterhof gebrauchte Kleidungsstücke ab. In der Startphase kauft das Familiengeschäft auch Ware aus zweiter Hand zu. Wer seine Stücke nicht umsonst abgeben will, erhält einen Drittel des geschätzten Weiterverkaufspreises. Weil die Familie die Kleider aber vorab bezahlt, birgt dieses Modell für sie ein finanzielles Risiko. Darum sagt Yannic: «Unser grosses Ziel ist, dass Olten und Region uns über Spenden mit Kleidern versorgt.» Gelingt dies, könnten sie umso fairere Preise anbieten. Abgesehen von den Secondhand-Kleidern gibt’s im Laden ein Schauregal, auf dem kleine Kunsthandwerk-Labels eine Plattform erhalten. Wer selbstgefertigte Ware bei ihnen verkaufen möchte, kann einen Platz auf dem Regal mieten. Derzeit arbeitet der Hinterhof beispielsweise mit dem Label TheGreenWolf aus Zürich zusammen, der Mikrogarten-Workshops organisiert.
Dass ein grosses Potenzial für ein Ladenkonzept wie ihres besteht, merkte Regina Graber durch ihr privates Hobby. Mit einer Freundin organisierte sie im eigenen Keller über mehrere Jahre regelmässig Secondhand-Kleiderbörsen im Kleinformat. «Wir haben gemerkt, wie stark das zieht. Es machte wusch und wir hatten vier Kellerräume gefüllt», erzählt sie.
Konsumlust stillen, aber ökologisch
Vor einem Jahr lancierte sie mit ihren Söhnen das Secondhand-Ladenprojekt. Gemeinsam begaben sie sich auf die Suche nach einem geeigneten Lokal. «Wir sagten, lass es uns versuchen. Vielleicht passt der Laden gerade in unsere Lebenssituation.» Alle drei führen trotz neuem Abenteuer ihre anderen Lebensprojekte weiter – der Laden bleibt zumindest vorerst eine Nebenbeschäftigung.

Nicht ausschliesslich der karitative, auch der ökologische Gedanke ist für ihre Ladenidee zentral. «Wir leben in einem solchen Überfluss, wir alle haben daheim volle Schränke. Eigentlich muss gar nicht viel Neues produziert werden. Indem wir bereits produzierte alte Schätze wiederentdecken, können wir unsere Konsumlust stillen. Alle wollen ein wenig Veränderung in ihrem Leben», sagt Regina. Der Familie Graber Aeschbacher war es wichtig, den Aspekt des Rezyklierens vorzuleben. Deshalb ist auch die Ladeneinrichtung aus zweiter Hand. Sie stammt aus dem ehemaligen Oltner Kleiderladen «Casa Moda», die Kasse ist ein Überbleibsel aus dem Caritas-Laden. «Bis auf den Klebstreifen ist nichts neu hier», scherzt Regina.
Eigentlich hätte die Familie Graber Aeschbacher gerne ein Lokal auf der rechten Aareseite der Stadt gefunden. Alle drei wohnen in dieser Gegend und sie hätten, wie sie sagen, was zum Aufschwung beitragen wollen, der in den letzten Jahren auszumachen sei. Aber die Verhandlungen um das gewünschte Lokal versiebten im Nichts. An freien Ladenlokalen und Gewerbeflächen mangelts in der Kleinstadt bekanntlich nicht. Trotzdem gestaltet sich die Suche nach einem Lokal für ein Start-up-Projekt wie jenes der Familie Graber Aeschbacher als schwierig. Dies merkten sie bei den vielen Besichtigungen und Telefonaten bald.
Panorama der leerstehenden Ladenlokale
«Wir haben unzählige Lokale angeschaut, wussten über alle Mietpreise Bescheid», sagt Regina. Die Reaktionen der Verwaltungen waren vielerorts ähnlich, erzählt Léon. Unter anderem habe er zu hören bekommen: «Was, ich soll mit dem Preis runter?! Ihr macht mir den Laden ja sowieso kaputt.» Die Resonanz sei insgesamt sehr skeptisch gewesen. Beispielsweise bei einem Mietpreis von über 2000 Franken für 75 Quadratmeter hätte er maximal 100 Franken Mietreduktion herausschlagen können. «Dann lassen Sie es lieber leer?», habe er jeweils gefragt. Die Antwort: «Ja, wir lassen es lieber leer.» Vielleicht habe diese Haltung auch damit zu tun, dass die Eigentümer vielmals nicht Oltnerinnen sind und sich deshalb weniger mit dem Ort und den in Olten vorhandenen Ideen identifizieren, vermutet Regina.

Eine weitere grosse Hürde: Oftmals regelt ein Vertrag über fünf Jahre die Mindestmietdauer. Für Regina und ihre beiden Söhne aber war klar, dass sie ihr Ladenkonzept zunächst für ein Jahr ausprobieren wollen. Sie sagt: «Was ich ernüchternd finde: Die Allgemeinheit beklagt, in der Innenstadt gäbe es zu viel Leerstand, der Ladenmix sei schlecht, die Altstadt biete ein Trauerspiel und so weiter. Gleichzeitig geht es doch allen noch zu gut, sonst würde man schneller reagieren, würden die Lokale vereinfacht rausgegeben, um die Stadt mehr zu beleben.»
Hinter der verkehrsbefreiten Kirchgasse, wo das Leben dank Gastronomie stärker als früher pulsiert, fand die Familie Graber Aeschbacher doch noch, was sie suchte. Ein Lokal mit industriellem Charme, einen Einjahresvertrag und eine dialogfreudige Verwaltung. Erleichtert hat sich die Situation auch dadurch, dass sich eine kombinierte Mietlösung ergab. Die Cousine der Aeschbacher-Brüder eröffnet im oberen Teil der Liegenschaft ihr Bauplanungsbüro. «So haben wir neun Monate Zeit, unser Ladenmodell auszuprobieren und wir müssen nicht die ganze Miete tragen.» Sie glauben daran, mit ihrem Laden den Nerv der Zeit zu treffen. Über zwei Besucherinnen freuten sie sich in den Startwochen besonders: Zwei Teenies kamen extra aus dem Gäu, um den Hinterhof aufzusuchen.