Der wiedergenesene Maestro, ein poetischer Pilot und das perfide Virus
1. «Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas»
(«Und wenn wir jene feierten, die nichts zu feiern haben?»)
Der belgische Musiker Stromae in seiner Comeback-Single «Santé», 2021
Stromae gehört zum Glück nicht zum Club 27, also jenen Musikern, die mit 27 starben. Aber auch er verschwand urplötzlich von der grossen Bühne. 2015 war das, nachdem ihm Welthits wie «Alors on danse» oder «Formidable» gelungen waren. Er war gerade auf Afrikatournee, als er wegen Panikattacken alle Konzerte absagen musste.
Wie er später erklärte, waren diese durch ein Malaria-Medikament ausgelöst worden – und hörten nicht mehr auf. Er, der sich in seiner Kunst immer für die Vulnerablen eingesetzt hatte, gehörte plötzlich selbst zu diesen. Nun, sechs Jahre später, ist Stromae ebenso plötzlich und gottlob zurück. Er hat kürzlich seine neue Single «Santé» veröffentlicht, die in bester Stromae-Manier gleichzeitig zum Tanzen und zum Nachdenken anregt. Auch der Titel kann vielschichtig gedeutet werden; die Comeback-Single nach krankheitsbedingter Absenz «Gesundheit» zu taufen und diesen Song in Zeiten der Pandemie den Menschen zu widmen, die arbeiten, während andere feiern, Krankenpfleger etwa, und auf diese anzustossen – Santé! –, das ist schonmal eine gute Basis für ein Comeback.
Der Song selbst zeigt dann, dass Stromae auch sonst nichts von seiner Genialität eingebüsst hat; er bleibt unverkennbar in Rhythmus und famoser Stimme, Stromae bleibt der Maestro, den sein Künstlername suggeriert: Verlan nennt sich dieses Sprachspiel, wenn die Silben vertauscht werden, das besonders im französischen Immigranten-Slang weitverbreitet ist. «Verlan» selber ist auch ein Verlan («à l’envers», also «verkehrt herum»).
Mit richtigem Namen heisst der 36-Jährige Paul van Haver. Seiner neuen Single wird ein ganzes neues Album folgen und diesem eine neue Tournee, die auch in die Schweiz führt: Am 24. Juli 2022 tritt der Belgier, dessen Vater aus Ruanda stammte und im dortigen Bürgerkrieg ums Leben kam (darum der Songname des Hits «Papaoutai»?), am Paléo-Festival in Nyon auf. Das Festival ist leider ausverkauft, aber wenn ich sonst einmal zu «Santé» tanze, werde ich mit Stromae gedanklich auf jene anstossen, die wenig zu feiern haben. Und hoffen, dass der Maestro gesund bleibt.
Meine Lieblingslieder des Monats: Playlist auf Spotify
PS. Apropos Spotify: Meine letzte KOLT-Kolumne hat Wirkung gezeigt, «Spotify versteckt den ‹Shuffle›-Button». Vielleicht hat der Artikel vom Tagi aber auch recht, und es war nicht ich, sondern Adele, die Spotify zum Handeln brachte.
2. «Dee-cide! Dee-cide!»
Computerstimme in Flugzeugen vor der Landung, zitiert von Pilot Mark Vanhoenacker im Buch «Skyfaring».
Wenn Mark Vanhoenacker als Pilot so gut ist wie als Buchautor, dann möchte ich in Zukunft nur noch mit Mark Vanhoenacker fliegen. Der belgisch-amerikanische Doppelbürger hat vor fünf Jahren erstmals ein Buch über das Fliegen veröffentlicht. «Skyfaring» ist auch für Nichtaviatiker faszinierend, weil Vanhoenacker der Fliegerei ein Stück Poesie zurückgibt und auch vermeintlichen Banalitäten wie Computerdurchsagen im Cockpit geistreiche Gedanken abgewinnt. So erzählt er beispielsweise, wie irgendwann im Landeanflug das Flugzeug jeweils zur Pilotin sagt: «Decide!». Entscheide! Der Airbus spricht mit Männerstimme, bei Boeing ist es eine weibliche; beide tun das auf der sogenannten Entscheidungshöhe, freundlich, aber bestimmt und mit dieser Computerintonation: Deeee – cide!, und zwar sofort, zwischen Luft und Erde, Landung oder nicht. Es geht um die Frage: Siehst du genug, um landen zu können?
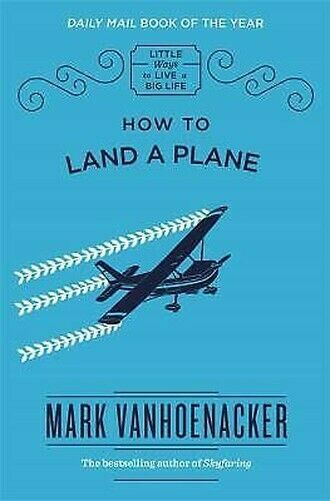
Mark Vanhoenacker führt dann aus, wie er sich wünschte, dass solche programmierten Aufrufe auch in anderen Lebenssituationen hin und wieder erklängen, bei langatmigen Sitzungen zum Beispiel. Manchmal, im Alltag, wenn er kleine Entscheidungen aufschiebt, sage er zu sich selbst, den 747-Akzent imitierend: Deee-cide! Er nennt das die 747-Entscheidungsfindung-Strategie. Apropos Landen: Sein letztes Buch heisst «Wie man ein Flugzeug landet». Darin steht am Anfang: «Wenn sie dieses Buch geöffnet haben, weil sie gerade ein Flugzeug landen müssen, aber kein Pilot sind, können Sie die Einführung überspringen und direkt zu Kapitel 2 ‹Aviate, Navigate, Communicate› übergehen.»
PS. Weiterer guter Flugzeug-Stoff auch für Leute, die sich nicht besonders für Flugzeuge interessieren: der neue Film «Boîte noir», in dem ein Absturz in einem richtig guten Thriller mündet, sowie dieses Video mit Captain Sully, in dem er in zwölf Minuten Schritt für Schritt erklärt, wie es ihm gelang, sein Flugzeug im Hudson River zu landen.
3. «Nicht jeder Wissenschaftler oder Arzt, der Zeit hat, in Talkshows zu gehen, ist immer gleich der beste Experte – manchmal ist es auch umgekehrt.»
Prof. Dr. Michael Hallek, Leiter Intensivmedizin der Uniklinik Köln, im Podcast «Das Politikteil» der «Zeit»
Es kommt auch nach bald zwei Jahren Pandemie noch vor, dass ich es interessant finde, Menschen zuzuhören, wie sie über die Pandemie sprechen. Aber es kommt schon nicht mehr oft vor. Eine gute Ausnahme erlebte ich kürzlich beim Podcasthören. Prof. Dr. Michael Hallek, Leiter Intensivmedizin der Uni Köln, sprach in einem Zeit-Podcast über die Pandemie oder genauer darüber, warum gerade Deutschland in dieser Krise immer wieder versagt.
Man möchte den Deutschen zurufen, dass sie nicht alleine sind im Versagen. Es ist ja auch recht schwierig, nicht zu versagen gegen dieses Virus, das, wie Hallek sagt, eine so wahnsinnig tückische Mischung mitbringt aus hoher Infektiosität und einer gewissen Letalität – aus Sicht einer Gesellschaft könne ein Virus kaum verheerender designt sein, sagt er. Wäre es tödlicher, würde es sich weniger verbreiten und damit gesamtgesellschaftlich weniger Schaden verursachen. Uniprofessor Hallek deckt in seiner Analyse auch schonungslos auf, wie unsere Mediengesellschaft sich schwertut im Meistern der Krise. Dass Social Media Spaltung vorantreibt, ist nichts Neues. Die Probleme sind aber vielfältiger: «Nicht jeder Wissenschaftler oder Arzt, der Zeit hat, in Talkshows zu gehen, ist immer gleich der beste Experte – manchmal ist es auch umgekehrt», sagt Hallek exemplarisch.
Dennoch bleibt sein Fazit, dass wir der aktuellen Gefahr nur als Gesellschaft begegnen können. Das dünkt mich eine gute Botschaft: Es ist Zeit, wieder zusammenzurücken. Denn in einem sollten sich Massnahmenskeptiker und Impfgegnerinnen auf der einen Seite, Angehörige von Opfern und solche, die um ihre Gesundheit fürchten, auf der anderen Seite, mittlerweile einig sein: Das perfide Virus mit all seinen Folgen (nicht nur den gesundheitlichen) ist tatsächlich eine Gefahr für unsere Gesellschaft.
PS. «Mitem Hümpu ids Agility»: Was Leute in Bern antworten, wenn sie eine Einladung für ein Feierabendbier ausschlagen müssen. Mehr von Tinu Salzmann

* Pierre Hagmann war erster Chefredaktor von KOLT, stammt aus Olten und blickt heute von Bern auf die schöne, komische Welt.








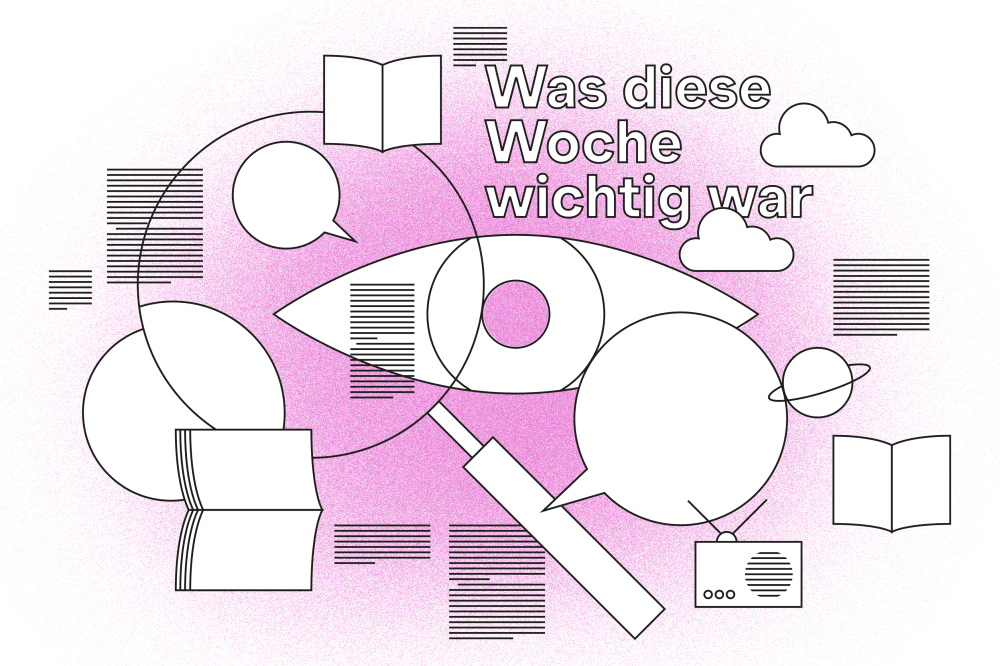


Welcher Satz hat dir diesen Monat zu denken gegeben?