Ich bin Oltner Bürgerin. Nicht etwa weil ich in Olten wohne, sondern weil Olten mein Heimatort ist. Wie ich das einer Freundin aus dem Ausland erklären würde? Keine Ahnung. Ich weiss ja selber nicht, was das genau bedeutet.
Auf jeden Fall hat mich Peter Schafer im letzten Dezember wieder einmal daran erinnert – mit einem Brief, der die Abschaffung der Oltner Bürgergemeinde forderte. Genauer gesagt: ihre Fusion mit der Einwohnergemeinde.
Das wollte der ehemalige Stadtrat Schafer mit einer Motion erreichen, die den Bürgerrat (das Exekutivorgan der Oltner Bürgergemeinde) aufgefordert hätte, mit der Einwohnergemeinde Fusionsgespräche aufzunehmen. Der Brief ging an die rund 1400 in Olten wohnhaften Oltner Bürgerinnen und Bürger, die über dieses Vorhaben abstimmen konnten.
An der Bürgergemeindeversammlung – von deren Existenz ich bis dahin nichts gewusst hatte – hätte ich also über den Weiterbestand der Oltner Bürgergemeinde mitbestimmen können. Im Restaurant Aarhof, am 6. Dezember 2021.
Habe ich aber nicht, weil ich den Brief viel zu spät geöffnet habe. Vielleicht ist das eine dumme Ausrede, und ich hätte auch sonst nicht an dieser Versammlung teilgenommen – ich weiss es nicht genau.
Nun denn, die 51 Bürgerinnen und Bürger, die sich im Aarhof einfanden (viermal mehr als letztes Jahr!), wollten nichts wissen von dieser Idee. Sich selbst abschaffen, wenn man sich schon in den Aarhof bewegt, um sich zu versammeln? Sicher nicht. Die Vorlage wurde abgeschmettert. Die Bürgergemeinde Olten existiert also weiter. Und macht was genau?
Burgen, Wald und Schweizer Pässe
Um das herauszufinden, gehe ich zu Besuch ins Oltner Bürgerhaus. Froburgstrasse, dritter Stock, Bürgerratssaal. Massive Tafel, samtig rote Stühle, an den Wänden Gemälde von altehrwürdigen Oltnern, ihre Namen kunstvoll ins Wandholz geschnitzt.
Bürgerpräsident Felix Frey empfängt mich. Er ist seit 1997 im Amt. Wir setzen uns an die lange Tafel, an der man sich klein fühlt und wichtig zugleich. Von allen Seiten blicken die gemalten Herren auf uns nieder: Wohltäter, Industrielle, ein Bundesrat.
«Hier tagt der Bürgerrat. Und je nach Anzahl Teilnehmenden auch die Bürgerversammlung», sagt Frey. Dann erklärt er, was die Oltner Bürgergemeinde tut: Sie besitzt und verwaltet Wald und Liegenschaften in und um Olten, führt das Altersheim Weingarten und ist für die Erteilung des Bürgerrechts zuständig.
Ein Teil der Liegenschaften befindet sich in der alten Stadtmauer, andere sind Landwirtschaftsbetriebe ausserhalb von Olten, und wieder andere sind die Hofgüter: die Froburg und das Säli-Schlössli.

«Finanziell wirft das alles nicht viel ab. Gerade die Instandhaltung des Säli-Schlössli ist um einiges teurer als der Ertrag des Betriebs», sagt Frey. «Und unsere Kosten werden ja nicht durch Steuern gedeckt. Wir finanzieren uns nur über die Erträge aus unserem Besitz.»
Dann sind da noch die Einbürgerungen. «Hier führt eine Kommission Gespräche mit den Kandidierenden, und der Bürgerrat entscheidet dann abschliessend, ob er das Gesuch gutheisst.»
Heute sei die Entscheidungsmacht des Bürgerrats aber stark eingeschränkt durch nationale und kantonale Gesetzgebung.
«Wir lehnen heute nur noch selten Einbürgerungsgesuche ab», sagt Felix Frey. «Früher waren die Kompetenzen anders, bis Anfang 90er Jahre hatten die Bürgergemeinden mehr Spielraum. Da gab es Gemeinden, die bürgerten per se kaum Ausländer ein.»
Wie demokratisch ist es, dass diese Kompetenz dem Bürgerrat zukommt?
Ehrenamt und Heimatverbundenheit
«Nicht weniger demokratisch, als wenn das die Einwohnergemeinde machen würde», findet Felix Frey, der seit 25 Jahren Präsident ist. Der Bürgerrat werde auch demokratisch gewählt, grundsätzlich per Urnengang (unter den Bürgerinnen) alle vier Jahre.
«Stille Wahlen sind jedoch möglich, wenn bei einer Vakanz nicht mehr Kandidaten als Sitze zur Diskussion stehen. In den letzten Jahren haben wir das so gemacht,» räumt er ein.
Das heisst konkret, dass seit mehr als acht Jahren keine eigentlichen Wahlen mehr durchgeführt wurden. «Ein Urnengang bedeutet auch immer Kosten und Aufwand.»
Kosten und Aufwand für ein Gremium, das abgesehen von kleinen Sitzungsgeldern grösstenteils ehrenamtlich tätig ist. Finanziell trage man wirklich keine Vorteile aus der Bürgerschaft, betont Frey wieder.
Weshalb ist es trotzdem noch wichtig, dass die Bürgergemeinde heute weiter existiert?
«Sie stärkt die Heimatverbundenheit», sagt Frey. «Oltner Bürgerinnen und Bürger haben eine langfristigere Sicht auf die Entwicklung der Stadt. Es sind Menschen, die sich mit diesem Ort identifizieren und die nicht nach zwei, drei Jahren wieder wegziehen. Das beeinflusst ihre Haltung bei Entscheiden. Etwa um nicht unnötig Geld auszugeben für kurzsichtige Projekte.»
Der Gewinn der Bürgergemeinde, wenn sie denn welchen erwirtschaftet, komme der Allgemeinheit zugute, so Frey. Wie, entscheidet die Bürgergemeinde. Bis zu einem Betrag von 100’000 Franken kann der Bürgerrat selbständig bestimmen, wie und wo investiert oder gespart wird. Für höhere Beträge ist die Bürgerversammlung zuständig.


Aus Hintersassen wurden Neubürger: die Geschichte
Um zu verstehen, weshalb es Bürgergemeinden in der Schweiz überhaupt neben den Einwohnergemeinden gibt, ist ein Blick in die Vergangenheit zwingend.
Früher, das heisst vor 1800, waren die Bewohner von Schweizer Städten und Dörfern aufgeteilt in alteingesessene Bürger und rechtlose «Hintersassen» (zum Beispiel Zugezogene). Damit wurden Rechte wie die Nutzung von Gemeindegut, aber auch Pflichten wie die Armenfürsorge auf einen definierten Kreis von Personen beschränkt.
In der Helvetik, der Zeit um 1800, als die Französische Revolution auf die alte Schweizerische Eidgenossenschaft übergriff, wurden die Einwohnerrechte neu definiert: Nun wurden alle Einwohner gleichgestellt. Einwohnergemeinden sollten die historisch gewachsenen Bürgergemeinden ablösen.
Im Gegensatz zur alten Ordnung, die Bürgerrechte nach Geburt verlieh, erhielten die Einwohnerrechte neu alle Personen, die auf dem Gemeindegebiet wohnten.
Damit waren aber nicht alle einverstanden. Wem sollten jetzt die bürgerlichen Güter zustehen? Wald, Allmende, solche Dinge? Doch nicht etwa allen Einwohnern?
Die begüterten Dorfgenossen und Stadtbürger wollten ihre Rechte nicht mit den (meist ärmeren) «Neubürgern» teilen. So gründeten sie die Bürgergemeinden, und denen blieb weiterhin die Nutzung des Gemeindeguts vorbehalten.

Die Gegenwart
Die Kompromisslösung von damals gilt in zahlreichen Kantonen bis heute: Es gibt Einwohnergemeinden und Bürgergemeinden, die nebeneinander existieren. Bürgerrechte erhält man grundsätzlich durch Geburt, Einwohnerrechte durch Wohnsitz.
Deshalb kann ich heute Oltner Bürgerin sein und in einer anderen Stadt wohnen. Und deshalb könnte eine Oltnerin, die zwar hier wohnt, aber nicht Bürgerin ist, nie in der hiesigen Einbürgerungskommission sitzen.
Der Kritiker von Olten
All das passt Peter Schafer offenbar nicht. Ich treffe den Mann, der die Bürgergemeinde abschaffen wollte, im Oltner Bahnhofbuffet. Das passt: Er ist sowohl Lokführer als auch stolzer Oltner.
Er identifiziere sich stark mit dieser Stadt, sagt er, und hat auch deshalb sich vor vielen Jahren einbürgern lassen – ist also auf Antrag Oltner Bürger geworden, zusätzlich zu seinem ersten Heimatort im Kanton Freiburg. Während zwei Jahren sass Schafer sogar im Oltner Bürgerrat.
Und trotzdem wollte er im letzten Dezember die Oltner Bürgergemeinde fusionieren.
«Sie ist absolut unnötig», sagt er. Das habe er schon früher so formuliert, auch vor und während seiner Amtszeit im Bürgerrat. «Die Bürgergemeinde hat keine Funktion, die ihre Existenz rechtfertigt. Einbürgerungen, Wald, Liegenschaften verwalten: All das könnte die Einwohnergemeinde effizienter erledigen. Und wäre dabei erst noch demokratischer.»

«Das Ego der alten Männer»
Undemokratisch findet Schafer vor allem, dass es für den Bürgerrat und die Kommissionen keine transparenten Verfahren gebe. In den Bürgerrat komme, wer nachrutsche, wer dem Präsidenten verbunden sei, wessen Gesicht man kenne. Vakanzen würden nicht ausgeschrieben und schon gar nicht an der Urne gewählt – entgegen dem Öffentlichkeitsprinzip.
«Und diese Menschen verfügen dann über Aufgaben, die das Gemeinwohl betreffen und die erst noch besser von der Einwohnergemeinde erledigt würden. Das ist eine unnütze Doppelspurigkeit.»
Nicht einmal finanziell lohne sich das Bestehen der Bürgergemeinde noch. Die Verwaltung von Vermögen und Liegenschaften koste mehr, als sie einbringe.
Und warum besteht diese offenbar serbelnde Institution dann noch immer? «Es ist das Ego der alten Männer», sagt Schafer. Reine Nostalgie also, wenn es nach ihm geht.
Er rührt im Kaffee, nickt und wiederholt: «Das Ego der Veteranen.»
Wie lange diese verbindende Nostalgie noch ausreicht, um die Bürgergemeinde am Leben zu halten, werde sich zeigen. «Der Ruf nach der Fusion kam für die alteingesessenen Herren und Damen wohl aus der falschen Ecke, weil ich schon immer kritisch eingestellt war. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt.»

Bröckelnde Bedeutung, aber nicht überall
Schweizweit gesehen bestehen bei der Bedeutung der Bürgergemeinden grosse kantonale Unterschiede.
In der Westschweiz etwa haben nie Bürgergemeinden existiert, oder sie wurden schon lange abgeschafft. An anderen Orten verschwinden sie langsam. Entweder ganze Kantone, wie 2005 Luzern, oder einzelne Gemeinden lösen ihre Bürgergemeinden vermehrt auf. So haben in den letzten Jahren im Kanton Solothurn 28 Bürgergemeinden mit den Einwohnergemeinden fusioniert.
Wieder andernorts, zum Beispiel in Bern, wäre das undenkbar.
Die Burgergemeinde, so nennt sie sich dort, besitzt etwa einen Drittel des städtischen Bodens, 70 Liegenschaften, ein Spital, ein Casino, eine Bibliothek, das naturhistorische Museum, eine Bank und noch viel mehr. Wo auch immer in der Stadt Bern Kulturgelder fliessen, steht irgendwo «Burgergemeinde» drauf. Sie ist als Institution kaum aus der Stadt wegzudenken.
Berns Säckelmeister
«Die Burgergemeinde vereint Werte wie Tradition und Kontinuität mit den Herausforderungen der Zukunft. Sie steht im Dienste der Bevölkerung und fördert das kulturelle, soziale und wissenschaftliche Leben in der Stadt Bern», lese ich auf der Homepage der Burgergemeinde Bern.
Gleichzeitig führen mich meine Recherchen in virtuelle Berner Rittersäle: Das Surfen auf der Website der Berner Burgergesellschaft, einer Untergruppe der Burgergemeinde, fühlt sich nach Museumsbesuch an. Oben prangt zentral ein Berner Wappen. Darunter finde ich eine Übersicht über die Organe, die heisst «Vorgesetztenbott». Klicke ich an und erfahre: Im Vorgesetztenbott fungiert zum Beispiel ein «Stubenmeister», ein «Rodelführer» und auch ein «Säckelmeister».
Und unter «Anlässe» finde ich heraus, dass man sich regelmässig zum «Stubengesellen-Stamm» oder, je nach Geschlecht, zum «Damen-Stamm» trifft.
Ist das alles einfach schrecklich verstaubt? Ein Treffpunkt für Mittelalterfans? Oder ist dieser aristokratische Touch, der mich irgendwie beunruhigt, tatsächlich ernst zu nehmen angesichts des beachtlichen Vermögens, das diese Säckelmeister verwalten?
Was sind Bürgergemeinden nun wirklich: wohltätig, undemokratisch oder einfach nur veraltet?
Die Kritikerin von Bern
Rahel Ruch hat hierzu eine klare Meinung. «Die Burgergemeinde Bern ist ein Überbleibsel des Ancien Régime», sagt sie in einem Berner Café. «Sie ist vormodern, intransparent – und sehr einflussreich. Das ist das Problem.»
Die Berner Stadträtin (Grünes Bündnis) hat in der Vergangenheit immer wieder gegen die Burgergemeinde politisiert. Dabei ging sie aktivistischer vor als Peter Schafer: 2014 etwa sperrte sie einen Drittel des Berner Waisenhausplatzes ab, um auf die Burgergemeinde als grösste Landeigentümerin Berns aufmerksam zu machen.
«Wer in der Stadt Bern irgendetwas macht, in meinem Fall Stadtpolitik, kommt an den Burgern nicht vorbei», sagt sie.

Zwei von fünf Sitzen in der Stadtregierung sind von Burgern besetzt. Und auch in sämtlichen Parteien seien sie gut vertreten – von rechts bis links. Ausserdem wäre für eine Fusion mit der Einwohnergemeinde eine Änderung der Kantonsverfassung nötig. «Das ist politisch praktisch unmöglich zu erreichen. Auch haben sie sehr viel Geld. Und das schafft Abhängigkeiten.»
Dieses Geld und vor allem all das Land wäre, so Ruch, bei der Einwohnergemeinde besser aufgehoben.
«Es ist schlicht nicht demokratisch. Selbst wenn die Burgergemeinde ihr Vermögen ins Allgemeinwohl steckt – weshalb sollten sie überhaupt darüber verfügen? Warum muss die Stadt verhandeln über Dinge, die sie eigentlich entscheiden können sollte?» Zum Beispiel: soziale Wohnpolitik oder ob im Wald weniger Pestizide gespritzt werden. Oder wer den Schweizer Pass erhält.
Schweizweit sei diese Gemeindedualität ein Unsinn, findet Ruch. Ganz besonders wenn wie im Fall Bern besonders viel Vermögen im Spiel sei. Oder wie im Fall Olten die Entscheidungsmacht über Einbürgerungen.
«Es ist offensichtlich falsch. Aber dagegen vorzugehen ist nicht einfach.»
Zurück in Olten hängt das Säli-Schlössli im Nebel. Ich finde es schön und etwas kitschig und frage mich, ob das jetzt Heimatverbundenheit ist.
Schreiben Sie einen Kommentar Antworten abbrechen
Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.








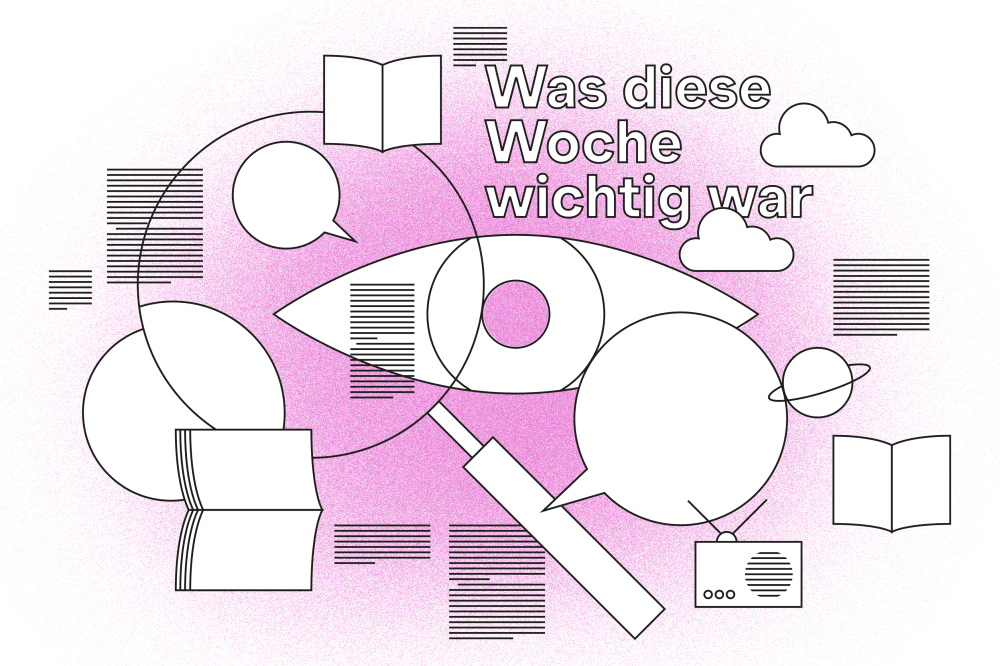


Die Bürgergemeinden – und mit ihnen das Bürgerrecht auf Gemeindeebene – sind hoffnungslos veraltet. Wenn wir die Organisation des Staatswesens heute völlig neu denken würden, käme wohl kaum jemand auf die Idee, so eine Struktur aufzubauen. Dass die Schweizer Staatsbürgerschaft nur in Kombination mit dem Gemeindebürgerrecht erlangt werden kann, ist eine tragisch (und bewusst?) hohe Hürde für Einbürgerungen. Es macht schlicht keinen Sinn und ist höchst undemokratisch, dass kleine, immobile Minderheiten (man muss schon sehr viel Sitzfleisch über Generationen haben, um am Ort des eigenen Bürgerrechts zu wohnen) über derartige Privilegien verfügen. Rahel Ruch fasst das Dilemma treffend zusammen: «Es ist offensichtlich falsch. Aber dagegen vorzugehen ist nicht einfach.»