«Dass wir nicht miteinander kommunizieren, ist ein Riesenproblem»
«Lüt wo vill reede
reede über jeede»
Das steht an der Wand der Gaststube im Dorf, wo sich die Leute nur für den Unterhaltungsabend der Dorfmusik schön machen, wo am Sonntag die Kirche leer und die Beiz voll ist, wo alle alles wissen und doch nicht die ganze Wahrheit.
Wo alle viel reden.
«Roland wusste, wie das lief. Hatten sie ihn erst einmal im Blick, Mutters Gäste, fielen ihnen plötzlich zahlreiche Geschichten zu ihm ein, die sie ihrem Sitznachbarn im Flüsterton erzählen mussten.
Alte Geschichten. Neue Geschichten.
Alte Geschichten neu erzählt.
Ein Graus war das.»
Alle reden viel – aber eben nur über- und nicht miteinander. Besonders dann, wenn es um die geht, die wirklich betroffen sind.
«Der Tschudin fragte sich, ob Sandra davon wusste. Vermutlich nicht. Sie war zu nahe an der Geschichte dran.
Er könnte es ihr sagen.
Er müsste es ihr sagen.
Aber er schwieg.
Er schwieg, weil er Sandra mochte.
Und er schwieg, weil alle schwiegen.»
Ein unspektakuläres Dorf irgendwo im Schweizer Hinterland, von Jurahügeln und Kirschbäumen umrahmt, das ist der Schauplatz von Rebekka Salms erstem Roman «Die Dinge beim Namen».
Zwölf in sich abgeschlossene Kapitel erzählen zwölf verschiedene Perspektiven auf dieselbe Geschichte: eine Vergewaltigung nach dem Unterhaltungsabend 1984. Und alle anderen Geschichten, die damit auf die eine oder die andere Weise zusammenhängen.
«Manchmal war eine Geschichte komplexer als die Geschichten, die man sich darüber erzählte, es erahnen lassen würden.»
Es geht um sexuellen Missbrauch, um verhärtete Geschlechterrollen, um häusliche Gewalt, Eifersucht, Prostitution, versteckte Homosexualität – und darum, wie das alles unter den Tisch gekehrt wird. Dem Dorffrieden zuliebe.
Und wie trotzdem alle darüber reden.
Das führt dazu, dass manch einer mehr über den anderen weiss als über sich selbst. Und irgendwie auch, dass niemand richtig glücklich ist im Dorf – und trotzdem alle dableiben.
«Die Dinge beim Namen» liest sich leicht, zumal die zwölf persönlichen Geschichten die eigene Neugier mühelos zu wecken vermögen. Der Leserin wird direkt der Spiegel vorgehalten: Sie liest weiter, weil das eigene klatschsüchtige Herz danach verlangt. Es nimmt einen schrecklich wunder, was die wahren Geschichten hinter all den Gerüchten sind. Und so liest man gierig Kapitel für Kapitel, bis die letzte Seite enttäuschend früh kommt und es sich ein wenig anfühlt, als wisse man zu viel. Als hätte man zu lange hinter gezogenen Vorhängen hervorgespienzelt.
Und immer wieder kommt der Gedanke: Ach, wenn die Protagonistin nur wüsste, was ich weiss. Wenn die Leute nur miteinander reden würden.
Wir haben – wenigstens das – mit der Autorin geredet. Rebekka Salm ist in Bubendorf bei Liestal aufgewachsen. Seit mindestens 20 Jahren hat sie dem Dorfleben den Rücken gekehrt und lebt heute in Olten. Für Kolt schreibt sie seit Kurzem Kolumnen. «Die Dinge beim Namen» hat sie neben ihren Jobs im Asylwesen, als Texterin und als Mutter verfasst. Vor zwei Jahren startete das Abenteuer. Jetzt ist der Roman im Buchhandel zu kaufen.

Rebekka Salm, wie schreibt man ein Buch?
Begonnen hat alles mit Kurzgeschichten. Davon habe ich einige geschrieben und mir dann gesagt, dass ich das kann. Aber einen Roman, das habe ich mir lange nicht zugetraut. Ich hatte es vor Jahren schon einmal versucht, doch da war meine Tochter noch zu klein und meine verfügbare Zeit zu knapp. So hat auch mein jetziger Roman seine Ursprünge in einer Kurzgeschichte. Aus einer wurden mehrere, und plötzlich merkte ich, dass sich daraus ein grösserer Plot entwickelt hatte. Das erklärt auch die in sich abgeschlossenen Kapitel, die jeweils die Geschichte einer Person aus dem Dorf erzählen.
Und plötzlich stand doch ein ganzer Roman?
Ausschlaggebend war der Kommentar einer Freundin. Sie fragte mich, ob ich denn auch irgendwann mal ein Projekt tatsächlich abschliessen würde. Das machte mich wütend genug, um es wirklich zu tun. Also sass ich immer wieder hin und schrieb, im Zug oder morgens, wenn meine Tochter in der Schule war. Das ist auch die Antwort auf die Frage, wie man ein Buch schreibt: Du setzt dich hin und schreibst nieder, was du im Kopf hast. Und lässt dich dabei möglichst wenig ablenken durch ungemachte Wäsche, schmutzige Fenster oder Instagram.
Deine Geschichte spricht patriarchale Strukturen in der ländlichen Schweiz an. Und die Probleme, die daraus resultieren – etwa, dass einer Frau die Mitschuld an einer Vergewaltigung gegeben wird. Hat der Text für dich eine politische Dimension?
Es geht in der Geschichte viel um Geschlechterverhältnisse. Das ist auf jeden Fall politisch, und es ist mir wichtig, dass das thematisiert wird. Ob aber ein explizit politischer Wille dahintersteht, kann ich gar nicht genau sagen. Sehr vordergründig war für mich beim Schreiben die Ebene der Kommunikation. Das Miteinander- und das Darüber-Reden, auch im Zusammenhang mit der Vergewaltigung.
Inwiefern?
Es ist sehr wichtig, wie über Geschehnisse gesprochen wird. Dass eine Vergewaltigung nicht als solche benannt, sondern gesagt wird, eine Frau sei «überstellt» worden, ist enorm prägend. In meiner Geschichte verändert sich mit der gesellschaftlichen Bewertung einer Vergewaltigung – und mit den Worten, die man für sie braucht – sogar die Bewertung des Ereignisses durch das Opfer selbst.
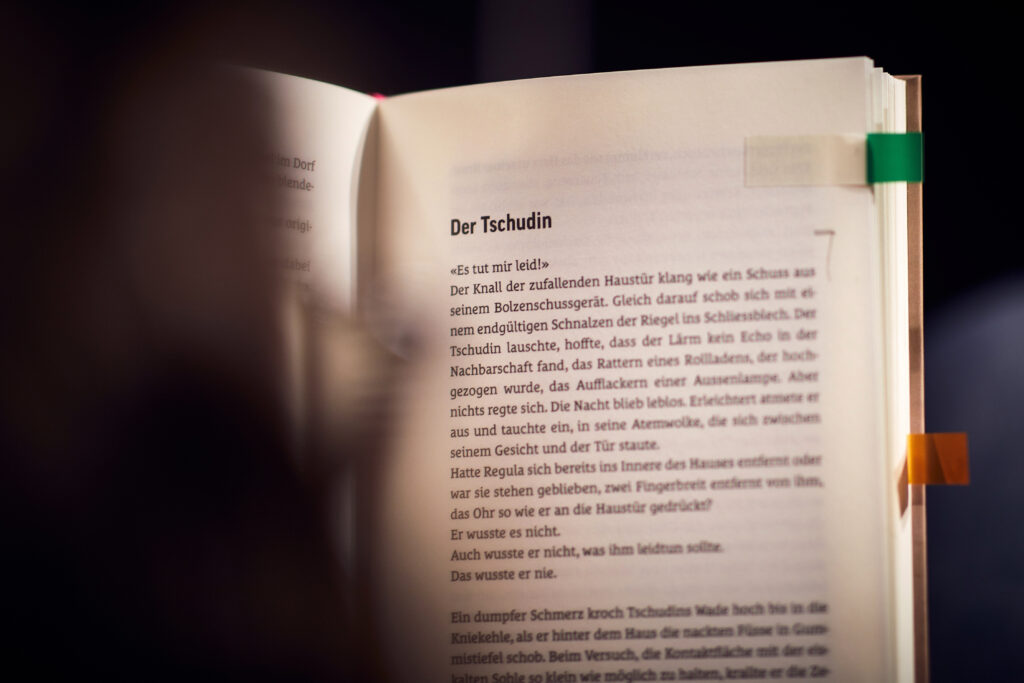
Das «Reden» steht im Zentrum deines Romans.
Ja, ganz klar. Dass wir nicht miteinander kommunizieren, wenn es um schwierige Themen geht, ist ein Riesenproblem. Das Schlimmste ist nicht das Tratschen, das im Dorf exzessiv praktiziert wird. Sondern, dass über die relevanten Themen dann nicht gesprochen wird, wenn es darauf ankommen würde. Dadurch, dass wir nicht offen und ehrlich auch über Unangenehmes sprechen, öffnen wir Türen für weiteres Ungemach.
Beschäftigt dich das in deinem eigenen Leben?
Ich arbeite in der Kommunikation – insofern beschäftigt mich das auf einer professionellen Ebene. Und persönlich sind mir solche Dynamiken nicht fremd. Ich komme selbst aus einer Familie und einem Dorf, in denen kaum über sogenannte Tabuthemen gesprochen wurde. Vieles aus dem Roman ist angelehnt an meine Erinnerungen ans Leben in Bubendorf. Doch es ist überspitzt dargestellt. Und wie es heute im Dorf läuft, weiss ich ja auch gar nicht mehr.
Was hast du dir in Bubendorf abgeschaut für den Roman?
Namen, Kulissen, Requisiten, Tendenzen, Stimmungen – aber keine Geschichten. Die habe ich erfunden. Ich habe nichts aus dem Roman wirklich erlebt, und doch hat er viel damit zu tun, wie ich das Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, wahrgenommen habe.
Und wie fühlt es sich an, dein fertiges Buch in den Händen zu halten?
Ich freue mich sehr, bin auch durchaus stolz. Und trotzdem ist da auch Scham. Damit hatte ich nicht gerechnet.
Scham wofür?
Etwa, dass ich vereinzelt die richtigen Namen verwendet habe von Menschen aus meinem Heimatdorf. Vom Metzger Tschudin zum Beispiel. Oder, dass ich eine dicke Frau als dümmlich darstelle und dabei, ohne es zu merken, stigmatisiere. Das ist mir bewusst geworden, als ich erfuhr, dass eine Bekannte mein Buch liest, die selbst Aktivistin gegen Fat-Shaming ist. Oder ich mache mir Sorgen, dass meine Geschichte als platter Heimatroman wahrgenommen wird. Kurz: Jetzt, wo es draussen ist, ist das Buch den Bewertungen aller Menschen ausgesetzt. Darüber habe ich keine Kontrolle mehr, und damit muss ich umgehen können. Das ist nicht einfach – aber trotzdem überwiegen die guten Gefühle. Immer wieder denke ich: Wow, jetzt ist es draussen. Wie cool. Und die ersten Rückmeldungen, die ich erhalten habe, befeuern dieses Gefühl.

«Die Dinge beim Namen» ist ab sofort online erhältlich beim Oltner Knapp-Verlag oder in der Buchhandlung deines Vertrauens, zum Beispiel bei Schreiber oder Klosterplatz.










