«Im Nachtleben hast du eine kurze Halbwertszeit»
Ohne es geplant zu haben, fanden sie in der tiefen Nacht ihre Berufung. Beide verkauften sie Nachtleben à discrétion. Beide haben mittlerweile damit aufgehört. Dabei hat es sich mit den Gemeinsamkeiten, könnte man meinen.
August Burkart erinnert mit seinem Kleidungsstil eher an einen Geschäftsmann. Und das war er im Grunde genommen, wie er selbst schildert. Er dachte immer gross. «Die Partykönige übers Mittelland», titelte die Aargauer Zeitung 2008 treffend. Mit seinem Kollegen Georgios Antoniadis, den alle George nannten, führte er im Ballungsraum Olten–Aarau die zwei grössten Diskotheken und mehrere Bars. «Pop Art» – der Name ihrer Firma war Programm, verkauften sie doch Nachtkultur für die Menschenmassen. Für viele unvergessen bleiben die Partys in der grössten Oltner Diskothek der Nullerjahre. Bis zu tausend Leute füllten das Metro an guten Abenden.
Einer davon war Daniel Kissling. Obwohl die Popkultur eigentlich nicht seine Welt ist. Seine Geschichte ist weitum bekannt. Mit seinem Coq d’Or schuf er ein Szenelokal für Subkulturen. Kultur und Kater verkaufte er. Sowas wie Popkultur bot das Lokal an den Donnerstagabenden mit dem 2.50-Franken-Bier. Und auch sonst war das Coq einfach ein Ort der Zuflucht in der späten Nacht. Seit dem letzten Frühsommer aber erhellt kein Licht mehr die gebogenen Fenster hinter dem Oltner Bahnhof.
Kolt-Treffen im Januar: Nachtleben – wo bist du?
Im neuen Jahr dreht sich am 7. Kolt-Treffen alles um das Oltner Nachtleben. Dieser Beitrag lanciert die Debatte. Am Montagabend, 31. Januar 2022, diskutieren wir mit verschiedensten Akteurinnen die Frage: Was funktioniert in unserer Kleinstadt und ihrer Region? Was könnte Olten brauchen, damit das Nachtleben wieder diverser wird? Trag dir das Datum in der Agenda ein und sei dabei, um mitzudiskutieren.

Hastig braust «Kissi» mit seinem unverkennbaren Lockenhaar ins Galicia, er hat sich verspätet. «Früher kam ich zu spät, weil ich 1000 Dinge hatte oder aber einen Kater. Jetzt ist’s, weil ich ein Kind habe», sagt er und lacht. Wir wollen es ihm verzeihen, denn zwischenzeitlich konnte August Burkart erzählen, wie er im Nachtleben strandete.
Alles begann mit einer Privatparty im Alten Spanier in Zofingen Ende der 90er-Jahre. Ein Kollege hatte ihn darum gebeten, für die Freunde aus jungen Jahren eine Party zu schmeissen. «Er war früh nach Zürich gezogen und hatte gut Geld verdient auf der Bank», erzählt August Burkart. Sound aus den 80er-Jahren, der Blüte der elektronischen Musik, sollte es sein. Burkart kontaktierte einen DJ mit Künstlernamen George, der mal im Moonwalker in Aarburg, wo Burkart herkommt, aufgelegt hatte. Die Party schlug voll ein. «Der Inhaber des Lokals sagte mir nachher, er habe noch nie so viele Anfragen im Vorfeld gekriegt.» Alle wollten zur Party, aber er musste allen absagen, weil sie privat war. «Du musst diese Party unbedingt nochmal machen», sagte er.
Der Ansturm war auch beim zweiten Mal enorm. «Ich vergesse nie mehr, wie ich rund 4000 Franken Bargeld in der Hosentasche hatte. Und alle wollten mich auf ein Getränk einladen», erinnert sich Burkart. Drink & Dance war geboren. Zwei Stunden lang gabs gratis Getränke, was sich als Startrampe für lange Tanznächte auswirkte. Mit diesem Partymodell füllten Gusti und George erst die Alte Post in Zofingen, später die Schützi in Olten. «Wir hatten so viele Menschen in die Schützi gelassen, dass wir sie nachher nie mehr kriegten.» Das Zofinger Tagblatt hielt diese Episode 2002 fest:
«Als er zu George an das Mischpult gegangen sei, habe ihn dieser ganz entsetzt angeschaut und gemeint: ‹Gusti, ich weiss nicht, was ich falsch mache. Die Riesenmenge johlt und singt, aber es tanzt keiner.› Gusti habe ihn dann aufgeklärt und gesagt: ‹George, sie können nicht, es hat da unten keinen Millimeter Platz mehr!›»

Was folgte, war eine schnell geschriebene Erfolgsgeschichte. Die beiden gründeten ihre eigene Eventfirma «Pop Art Veranstaltungen GmbH» und eröffneten in den Nullerjahren mit der Kettenbrücke in Aarau einen eigenen Nachtklub. «Hättest du mir zu jener Zeit ein gleiches oder ähnliches Lokal in Olten angeboten, wäre ich zu 100 Prozent nach Olten gekommen. Aarau war sowas von tot», sagt August Burkart heute. Mit ihren Popkultur-Partys trafen sie voll den Nerv der Zeit. Das Gastgewerbe in der Aargauer Kantonshauptstadt blühte neu auf. Angebote aus Luzern und Zürich flogen ihnen zu. Mit dem Metro betrieben sie rund ein Jahrzehnt lang parallel einen zweiten Klub. Hinzu kamen Bars wie der Platzhirsch oder das Opium in Aarau, das El Harem in Olten. Aber seit 2010 zogen sich die Pop-Art-Macher schrittweise zurück, gaben ein Lokal nach dem anderen auf.
Und heute?
Gusti, wie ihn alle nennen, lebt heute in Oftringen. Nach erfolgreichen Jahren im Nachtleben hat der 52-Jährige neue Lebensaufgaben gesucht. Neben einem Immobilienprojekt machte er gewissermassen ein zweites Mal im Leben ein Hobby zu seinem Standbein. Heute importiert August Burkart bekannte spanische Weine und verkauft diese in der Schweiz an Privatkunden. Schon 7000 Flaschen waren’s dieses Jahr, erzählt er.
Kissi hat nach dem Ende vom Coq d’Or mehr Zeit für sein Kind und engagiert sich als Milizpolitiker weiterhin für Olten jetzt! im Parlament. Neue Projektideen für ein Kulturlokal schwirren in seinem Kopf herum – er entwirft Konzepte fürs Nachtleben der Zukunft. Ob er sie je umsetzt, steht in den Sternen. Um leben zu können, schreibt er Texte, steht mal wieder hinter der Bar oder setzt er andere Kulturprojekte um.

Mit dem Nachtleben hält es sich wie mit anderen Gewerbezweigen. Es ist ungemein stark Zyklen unterworfen. Meist ist eine Bar oder eine Diskothek eng an die Person geknüpft, die dahintersteht. Das zeigt gerade die Geschichte von August Burkart. Oder jene von Daniel Kissling.
Aber auch die Galicia Bar ist ein Sinnbild dafür. Hinter dem Tresen steht wie immer am Montagabend Alex Capus, der Inhaber des Ladens selbst. Das in weinroten Farben dekorierte Lokal ist heute einer der Farbtupfer im Oltner Nachtleben. Gleich mehrere Bars verschwanden in den letzten Jahren. Das Terminus ist als einziger Nachtklub verblieben. Wohin, wer sich eine Nacht lang austoben will? Auf die simple Frage gibt’s momentan weniger Antworten als auch schon.
Wie kommt das Oltner Nachtleben wieder in die Gänge? August Burkart und Dani Kissling müssten es wissen, dachten wir. Also luden wir sie zum Bier ein. Mehr brauchte es nicht – über zwei Stunden sprachen sie von alten Erlebnissen und erzählten, was sie in all diesen langen Nächten erkannt hatten. Und wir merkten: Vielleicht haben sie doch mehr gemeinsam, als wir zunächst dachten.
Für die gute Party gibts kein Universalrezept. Trotzdem: Was ist für euch der gute Ausgang?
Gusti: Heute ist für mich ein gutes Essen und eine Flasche Wein schon Nachtleben. Vor der Flasche Wein sage ich: «Heute gehen wir aber noch weiter!» Um zehn gähne ich nur noch. Sonst geh ich mal einen befreundeten DJ anhören. Andrea Oliva arbeitete bei uns im Büro, heute ist er ein Superstar in Ibiza und legt in Ushuaia vor 12’000 Leuten auf. Er hätte damals schon weltweit auflegen können. Aber er hat einen strengen, italienischstämmigen Vater, der sagte: «Sohnemann, was du am Wochenende machst, ist mir egal, aber unter der Woche gehst du arbeiten.» Also arbeitete er bei uns, am Wochenende flog er in die weite Welt hinaus und kam am Montag mit kleinen Augen zurück.
Was machte eure Art von Nachtleben vor zehn Jahren so erfolgreich?
Gusti: Alles, was wir machten, war sehr kommerziell. Wir kamen in einer Zeit, die sehr elektronisch war. Wir kramten die alten Party- und Discohymnen hervor. Am Anfang wurden wir belächelt, plötzlich war es der neue Trend. Partys wie Saturday Nite Fever im Terminus waren ausverkauft, die Ü25-Partys ebenso. Wir waren gut im Copy-Pasten. Wenn mal was funktionierte, wiederholten wir es immer wieder.
Eure Ansprüche waren hoch. Wenn 250 Menschen zum Bligg-Konzert kamen, nanntest du dies eine «bezahlte Bandprobe». Im Coq wäre dies bereits ein grosses Fest gewesen.
Kissi: Die Zeiten haben sich geändert. In den letzten 20 Jahren sind viele Subgenres entstanden. Gerade, was die Tanzmusik betrifft. Das Exil in Zürich ist nicht gross, am Dienstagabend ist dort Reggaenacht. Dann kommen 200 Personen und das reicht ihnen. Wenn du eine breite Gesellschaft abdecken willst, musst du grösser sein. Da machst du anders Werbung. In den Bussen auf dem Land – mit den Plakaten.
Gusti: Wir konnten uns finanzieren, weil wir eine Fabrik wurden. So klein alles begann – am Ende hatten wir 110 Teilzeit- und 25 Vollzeitangestellte. Zuerst meinten wir, wir können in Olten die Location aus Aarau kopieren. Vergiss das. Aber das lernst du erst nachher. Wenn etwas funktioniert, verdienst du schnell gutes Geld. Aber etwas ausprobieren kostet immer Geld.

Kissi: Und dabei gilt es zu bedenken, dass bei Konzerten und Events die Kosten gleich hoch sind, egal ob du 250 oder 1000 Leute in der Bude hast. Die Technik, Verpflegung, das Barpersonal und so weiter.
Gusti: Genau, das machte mich fertig. Da legte dieser «verdammte» DJ George auf, der mein Partner war. Und es kamen wieder 800 Leute. Dann flogen wir eine Topband ein – Übernachtungen, Catering und Extramikrofone waren nötig. Kaum jemand kam. Mein Motto wurde immer mehr: Der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Fischer. Aber wir wurden älter, das Publikum blieb gleich alt. Also wussten wir gar nicht mehr, wie der Wurm riechen muss. Wenn ich den Jungen heute zuhöre, weiss ich nicht mal mehr, wovon sie sprechen.
Was habt ihr in eurer Fabrik verkauft, was war die Essenz? Im Coq d’Or war’s Kultur und Kater.
Gusti: Disco-Kultur. Die Kettenbrücke war eine 800er-Location, das Metro ein 1000er-Lokal. Klar hätten wir auch den einarmigen Flötenspieler einmal holen können, aber er wäre nicht happy gewesen mit den 40 Leuten und wir auch nicht. Beim Lotteriefonds anklopfen oder öffentliche Gelder einholen, um weniger kommerzielle Konzerte zu finanzieren, wollten wir nicht. Wir mussten niemandem Rechenschaft ablegen, ausser uns selbst.
Kissi: Wir waren 10 Flughöhen tiefer – aber selbst wenn du diese Grösse wie wir mit dem Coq d’Or hast, muss immer Geld reinkommen. Du bezahlst Löhne, du hast offene Getränkerechnungen …
Gusti: So toll es ist, wenn das Lokal voll ist, so traurig ist’s, wenn du nur ein halbvolles Haus hast. Als wir die Rechnung machten, was es kostet, wenn der Klub öffnet, erschraken wir zuerst. Wir brauchten Massen an Leuten. Alles andere hätte nicht geklappt.
Du kamst mit dem Coq d’Or fast nach der Pop-Art-Zeit.
Kissi: Meine Leute wuchsen mit dem auf, was wir machten. Rockmusik gab’s in Olten wenig. Einmal im Jahr das Mad Santa in der Schützi – im Metro die La-Roca-Veranstaltungsreihe. Die ersten 100 Liter Bier waren gratis, die haben wir übrigens auch immer genossen (beide lachen). Was es in Olten nicht gab, war alternative Kultur, die überrascht und du nicht kennst. Für uns war das einfach der Himmel. Klar konntest du ins Metro ans Drink & Dance, aber es war nicht dein Sound, eigentlich nicht deine Art Ausgang. Aber ich glaube guter Ausgang ist der Mix aus all dem.
Gusti: Je mehr in einer Stadt stattfindet, desto interessanter wird es für alle. Es ist egal, ob es verschiedene Bars und Klubs gibt. Je mehr, desto besser. Nachdem wir in Aarau die Kettenbrücke eröffnet hatten, kam plötzlich ein Lokal nach dem anderen. Wir dachten: «Jetzt wird’s nicht mehr so einfach für uns.» Das Gegenteil war der Fall.
Kissi: Das haben wir immer wieder erlebt. Wenn wir am Samstag eine Show angesagt hatten, blickten wir in die Agenda und dachten: «Geil, wir sind die Einzigen.» Aber dann kam an diese Show auch niemand. Am Wochenende danach war dies und jenes, überall waren die Lokale voll, auch bei uns. Wenn wenig läuft, gehen die Leute in eine andere Stadt oder bleiben daheim.

Dezentrale Kulturlokale wie das Coq d’Or oder das KIFF in Aarau haben’s also schwerer. Entweder sie machen sich einen Namen oder ziehen die Leute mit aussergewöhnlichem Programm an?
Gusti: Oder es etablieren sich Marken wie die Mafia-Partys im KIFF. In der Kettenbrücke am Ende der Altstadt hatten wir an einem schlechten Abend doch 400 Leute und 100 schneite es in den Morgenstunden noch runter. «Komm, wir gehen noch in die doofe Kettenbrücke», sagten die Leute mangels Alternativen.
Kissi: So läufts im Moment beim Terminus. Es würden noch mehr dahin gehen, wenn sie wüssten, sie hätten um halb 2 noch eine Auswahl. Jetzt gibt’s nur noch das Termi, oder du gehst in den Untergrund. Ich bin oft nach dem Metro in der Bar 97 gelandet. Die lebten extrem von ausgespuckten Klubgästen.
Gusti: Oh ja, scheisse (lacht). Alle gingen Pouletflügeli essen.
Kissi: Das war der Klassiker.
Gusti: Denen haben wir gerade nochmal die Bar gefüllt.
Kissi: Das ist der Kreislauf, den du brauchst. Du brauchst die Beizen, dann die erste Bar, wo du was trinkst oder das Konzert anhörst, dann den Klub, die Tanzfläche …
Wenn ein Investor käme, der Olten zu einer Nachtstadt machen will: Glaubt ihr, so geschaffene Institutionen würden funktionieren?
Gusti: Das wäre etwas retortenartig.
Kissi: Da müsstest du Leute von hier haben, die es betreiben, höchstens die Geldgeberin von sonst wo.
Gusti: Ich glaube schon, dass das Nachtleben natürlich wachsen muss. Wenn jemand Geld hat, muss er ein Lokal auch noch betreiben können.
Kissi: Es braucht Leute, die eine Community aufbauen können. Auf der grünen Wiese kannst du kein Nachtleben machen. Vielleicht ging das früher mal.
Gusti: Die Leute sind heute verwöhnt. Wenn du Bilder aus den Discos der 70er-Jahren siehst, da genügte eine farbige Birne, laute Musik – es war egal, wie sie tönte. Das war schon geil, eine Revolution.
Kissi: Im Untergrund geht’s schon noch rudimentärer, aber dann stehen der gemeinsame Geist, die Musik, die da läuft, die Menschen, die man kennt, im Vordergrund. Wenn du Masse willst, musst du Highclass sein, weil die Leute mit den Städten vergleichen. Sie wissen, wies in den grossen Klubs tönt.
Gusti: In der Disco gehts auch ums Sehen und Gesehenwerden. Ich weiss noch, als wir grosse Flaschen zu verkaufen begannen. Das hatte ich mal in Saint Tropez gesehen. Da bespritzten sich die Leute mit zwanzig- bis dreissigtausend Franken teuren Champagnerflaschen. Bei uns ging’s nicht darum, sich zu überschütten. Aber wer die grösste Flasche kaufte, war der Held der Nacht.

Das ist vermutlich, was du an der Popkultur verabscheust, Kissi?
Kissi: Ich sehe die Kulturpraktik, aber es war nicht unsere Klientel. Sobald es wirkte, als wollten wir Geld verdienen, waren die Kunden angepisst. Wir mussten immer zeigen, dass wir sozial sind. Wir konnten und wollten keine harten Preise verlangen. Bei einer Disco, an der – sagen wir – 600 Leute sind, ist der Eintritt kein Problem. Für ein Konzert einer unbekannten Band aber bezahlen die Leute nicht 15 Franken. Bei Klubnächten ist die soziale Komponente viel grösser. Ich hatte immer die Hoffnung, beides unter einen Hut zu bringen: Einen Discoabend zu machen und dann am Abend irgendwann einen Liveact auftreten zu lassen.
Gusti: Das habe ich im Kaufleuten erlebt. An einer Discoparty war da plötzlich Bonnie M. hinter dem Vorhang. Die Leute drehten durch. Wir haben mal DJ Tiësto geholt. 90 Minuten kosteten uns 60’000 Franken. Das Verrückte war, dass niemand uns glaubte, weil die Show lange nicht auf seiner Webseite aufgeführt war. Wir konnten dies tun, weil wir mit dem Perfect Friday einen der umsatzstärksten Freitage der ganzen Schweiz hatten. Jeden Freitag rund 13 Jahre lang hatten wir über 1000 Menschen im Klub. Niemand interessierte sich dafür, wer der DJ war. Wenn einer nicht mehr für 800 Franken Musik machen wollte, standen 20 hintendran und sagten, dass die gerne kommen. Da konnten wir auch mal experimentieren. Eigentlich würde es alles brauchen, das würde das Nachtleben am interessantesten machen. Dies sieht man in New York, London oder anderen Grossstädten.
Kissi: Wobei New York wegen der Gentrifizierung auch leidet. Ich war 2016 vor dem Cakeshop, dem wichtigsten Underground-Klub für die Indieszene aus den Nullerjahren. Alle amerikanischen Indierockbands spielten dort ihre ersten Konzerte. Vor dem Eingang hatte es grosse Schilder: «Bitte seid ruhig wegen der Nachbarn» oder «Wir müssen mit dem Konzert früher anfangen». Ich dachte, okay, es ist New York, aber das Problem ist das Gleiche wie in der Kleinstadt.
Gemäss dem, was ihr bisher gesagt habt, würdet ihr also sagen: Das Nachtleben kommt und geht mal wieder, das gehört dazu?
Gusti: Ja, es ist schon zufällig. Wir hatten mit der Kettenbrücke einen Saal, der eigentlich innerhalb eines Jahres zu einem Casino hätte werden sollen. Wir haben 2000 Franken Miete für den Saal bezahlt. Die Nachbarn fürchteten sich nicht, weil sie dachten, es sei bloss eine Zwischennutzung. Wir experimentierten, öffneten zunächst nur am Samstag und machten uns so rar. Als der Bundesrat die Casino-Lizenz an Baden vergab, kriegten wir einen Mietvertrag zu guten Bedingungen. Wir sagten immer: Zur Geburt und zur Beerdigung kommen alle. Aber der lange Weg ist der dazwischen. Da musst du überleben.

Brachliegende Lokale gäbe es in Olten eigentlich genug. Zum Beispiel die SBB-Werke …
Kissi: Da wären grosse Investitionen nötig. Ich habe ein Dutzend Lokale im Kopf, die toll wären. Aber mit einer Halle ist’s nicht gemacht. Entweder du hast Investoren, die es gut mit dir meinen, oder dann die öffentliche Hand. Fakt ist: Unter den Schweizer Konzertlokalen gibt’s kaum eins, das selbständig rentiert. Das Dynamo in Zürich ist ein Jugendhaus, das komplett durch die Stadt finanziert ist. Die Rote Fabrik ist zwar unabhängig, bekommt aber 2,5 Millionen Franken im Jahr. Das KIFF erhält jährlich 600’000 Franken von der Stadt. Das Kofmehl 100’000 Franken.
Gusti: Da frag ich mich dann: Braucht es eine solche Location? Wir haben auch in solchen Lokalen Events gemacht. Für mich war schnell klar, warum sie alle Jahre Geld abholen müssen.
Warum?
Gusti: Da ist zu viel Personal beschäftigt. Zwei arbeiteten, zwei rauchten – da würde ich als Inhaber gleich durchdrehen. Im Nachtleben kannst du während einer so kurzen Zeit Geld verdienen. Da musst du Vollgas geben. Dann gab’s Lokale mit drei Chefs, Unmengen an Barpersonal. Ich dachte immer: Wir könnten uns dies nie leisten.
Kissi: Es gibt sicher Orte, wo das Geld etwas genossen wird. Aber ich muss auch sagen, dass das Nachtleben übertrieben burnoutgefährdet ist. Es ist eine ungesunde Art, sein Geld zu verdienen. Du hast lange Schichten an der Bar, musst hart kalkulieren.
Gusti: An der Bar gibt’s immer wieder Abende, an welchen weniger läuft als gedacht. Da musst du das Barpersonal nach Hause schicken. Du kannst zwei Zahlen beeinflussen: die Waren- und die Personalkosten. Bei zu vielen Personalstunden verdienst du an einem mittelmässigen Abend bereits keinen Rappen mehr.
Kissi: Die Margen sind verdammt schwach, darum ist es jetzt mit Corona ein riesengrosses Problem.
Gusti: Darum habe ich jetzt meinen letzten Betrieb auch noch verkauft. Ich bin raus aus der Gastronomie. Es war schon vorher schwierig und es wird nicht einfacher. Ich denke sehr kommerziell, das verstecke ich auch nicht.
Aber wer sich umhört, spürt, dass die Lust am Nachtleben da ist. Gerade für die jungen Generationen ist in Olten jedoch ein Vakuum auszumachen.
Kissi: Die Nachfrage wäre vorhanden für einen guten Ort in Olten. Etwas Popartiges, für die breite Masse. Aber auch für den Untergrund. Nur ist die Rechnung verdammt schwierig. Jetzt etwas aufzumachen, ist der dümmste Zeitpunkt. Die Leute haben zum Teil verlernt auszugehen. Und ich frage mich immer, was mit den Teenies zwischen 16 und 20 ist, die nun diese Sozialisation nicht kennen.
Gusti: Genau, wissen sie noch, wies läuft, oder geht alles ins Private retour?
Kissi: Verdammt viele haben ihre Hausbar aufgerüstet in den letzten zwei Jahren. Andere haben ihren Bandraum ausgebaut, in welchem sie halbprivate Geschichten fahren können. Das Konzept war bisher: Leute treffen sich, weil sie den Ort, die Musik toll finden und trinken dazu Alkohol, was deine Haupteinnahmequelle ist. Eigentlich ist das eine junge Kulturform. Das gibt’s in dieser Art erst seit 100 Jahren. Kann gut sein, dass es nicht für immer so bleibt. Ich glaube aber, wir sind noch nicht an diesem Punkt.

Nachtkultur funktioniert aber noch immer, wie ich neulich im goldenen Fass in Basel selbst erlebte.
Kissi: Das ist die Art Lokal, das ich mir vorstellen könnte. Restaurant, Bar und Klub unter einem Dach. Du kannst so Buchhaltung, Personal, Werbung und alles andere zentralisieren.
Gusti: Eines der tollsten Eventzentren, das ich je gesehen habe, war in Thessaloniki, Griechenland. Auf einem alten Industrieareal mit roten Backsteinwänden gab’s Läden, Cafés, Klubs, Open-Air-Bars. Da waren Tausende Leute.
Kissi: Entweder du suchst die Laufkundschaft in der Stadt. Da hast du die Probleme der finanzierbaren Räume, des Platzes und Lärms. Oder du machst ein ganzes Areal in der Peripherie. Aber ich weiss, dass selbst die Rote Fabrik in Zürich Mühe hat, Leute dorthin zu kriegen.
Gusti: In der Innenstadt wird es immer schwieriger. Es gibt Einsprachen, bevor du einen Gedanken verschwendet hast. Was ich nicht begreife, ist, dass Leute in die Altstadt neben eine Bar wohnen gehen und sich brüskiert fühlen, weil im Sommer Leute draussen sind. Aarau hat sich deshalb klar bekannt, das fand ich richtig gut: Wir wollen eine Wohnstadt, aber auch eine kulturelle Stadt sein mit allem, was dazugehört. Wenn du die Ruhe des Landes suchst, musst du dorthin.
Kissi: Manchmal bekennt sich die Politik auch in die andere Richtung …
Gusti: In Zofingen war das krass damals. Die haben alles gekillt. Die Behörden haben den Riegel geschoben. Erst machten sie die Altstadt autofrei und das Gastgewerbe konnte raustischen. Sobald die Leute nach zehn Uhr nachts noch draussen waren, reklamierten die Anwohner. Die Behörden sagten: Zofingen soll eine Wohnstadt sein. Nach zehn Uhr darf nichts mehr leben. Seither sind das Gewerbe und die Gastronomie weggestorben.
Ich habe das Gefühl, ihr müsstet etwas zusammen machen. Gusti das Kommerzielle, Kissi lebt sich kulturell aus.
(Beide lachen)
Gusti: Nein, ich hatte eine super Zeit – von der Fetisch- bis zur Schlager-Party. Jetzt bin ich 52 und habe es gesehen.
Kissi: Man hat auch eine kurze Halbwertszeit im Nachtleben. Die Leute an der Front, an der Bar oder an der Tür – sie alle machen es nicht lang. Hinter der Bar bis am Morgen um 4 muss ich auch nicht mehr stehen. Aber ich glaube, meine Zeit ist noch nicht vorbei.
Gusti: Ich habe ganz am Anfang zuerst im Alten Spanier in Zofingen, dann im Terminus an der Bar gearbeitet.
Kissi: Alle haben so angefangen. Das Nachtleben ist ein Durchlauferhitzer. Bei einem Undergroundklub machst du alles. Ich war gefühlt am Donnerstagmittag im Coq und kam am Sonntagabend wieder heim. Nach vier Stunden Schlaf brachte ich den Bands noch das Frühstück.
Gusti: Aber die Band hatte Freude. Das ist schön, so nah dran zu sein.
Kissi: Das ist auch, was ich vermisse, dass man eine Rolle spielt in der Gesellschaft. Je nachdem auch in einem nationalen oder internationalen Netzwerk. Das Coq hinterlässt eine Lücke nicht nur in Olten, sondern in der Szene. Du bist Teil einer Kultur. Wie poppig sie auch ist, ob heavy oder schräg – es gibt auch diese Welt. Herr und Frau Oltner nimmt sie nicht wahr, sie interessieren sich nicht dafür. Ihr hattet ja die Fetischgeschichten im Metro.
Gusti: Ja, da kamen Leute von überall! Die Chärre kamen aus Deutschland, Österreich – halb Europa. Das Hotel Arte war im Voraus immer ausgebucht. 800 Leute kamen und alle zahlten 40 Stutz Eintritt.
Kissi: … nur mit Dresscode. (Beide lachen)








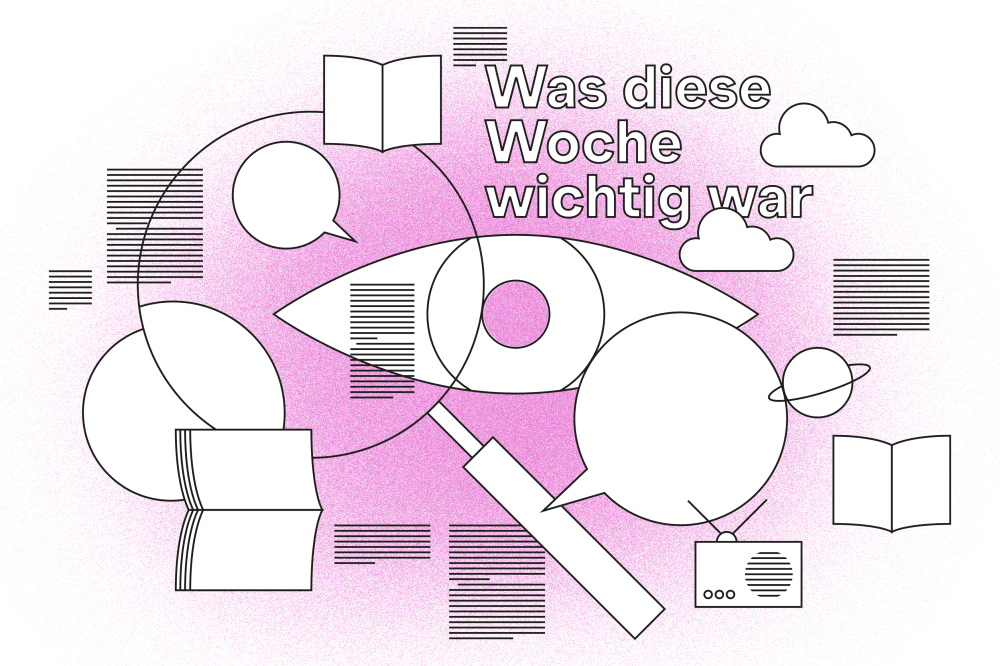


Was würdest du dir für das Oltner Nachtleben wünschen?