Wenn der Welthandel stockt: Das Rätsel der Lieferketten
Antworten darauf liefert uns Experte John P. Manning von der Fachhochschule Nordwestschweiz. Wir erreichen ihn per Videotelefongespräch im Homeoffice. Transparenz, sagt er gleich zu Beginn, sei das Gegenmittel, um die aus dem Lot geratenen Lieferketten zu reparieren. Nur, so einfach ist das nicht. Der Hochschuldozent sprach mit uns über das fragile System.
Der Flaschenhals, der defekte Reissverschluss, der sich nicht mehr schliessen lässt: Viele Bilder eignen sich, um die aktuellen Lieferengpässe als Metapher zu begreifen. Welches ist für Sie am passendsten?
John P. Manning: Der Flaschenhals passt sehr gut. Aber ich sehe auch das Bild einer geschlossenen Grenze vor mir, wenn ich an die Situation denke. Zum Flaschenhals: Jede Lieferkette verläuft bildlich gesprochen durch einen oder mehrere Trichter. Manchmal staut er wegen der Maschine. Manchmal ist auch der Mensch die Ursache. Etwa wenn wir nach England schauen, wo momentan die Lastwagenchauffeure fehlen. Die Abhängigkeit vom Menschen gilt derzeit auch für die Fracht-Flugindustrie. Für Unternehmen ist bei Lieferengpässen die Frage entscheidend: Wie viele Flaschenhälse habe ich? Sie müssen sich überlegen, ob eine einzige Quelle, im Fachjargon die Single Source genannt, ausreicht. Und zur Grenze: Bisher hielten wir geschlossene Grenzen nicht für möglich. Die Pandemie hat gezeigt, dass auch dadurch Lieferketten plötzlich gestört sein können.

Zur Person
Dr. John P. Manning stammt aus den USA und studierte physikalisch-technische Chemie. Seit über 30 Jahren lebt er in der Schweiz. Er arbeitete zunächst für Sandoz – und blieb nach der Fusion mit Novartis in der Pharmaproduktion tätig. Nachdem er vor eineinhalb Jahren in Frühpension ging, wechselte der Wahlschweizer an die Fachhochschule Nordwestschweiz. Er doziert zu digitalen Lieferketten (Digital Supply Chain) am Institut für Wirtschaftsinformatik der Hochschule für Wirtschaft in Basel.
Wie stark kriegen Sie als Wissenschaftler das Problem draussen in der Welt mit?
Zunächst habe ich es als Privatperson unmittelbar mitbekommen, als ich vor kurzem ein E-Auto kaufen wollte. Das Soundsystem, das ich wollte, war nicht verfügbar, weil die Chips nicht vorhanden sind. An der Hochschule interagieren wir mit der Wirtschaft in unserer Forschung und Lehre. Beispielsweise mit der global tätigen DHL. Obwohl diese Unternehmen stark betroffen sind, hört man sie kaum klagen. Neulich führte uns ein Seminar mit der Swiss WorldCargo vor Augen, wie stark die Passagier- und Cargoflüge in der Schweiz voneinander abhängen. Darum nahm die Swiss WorldCargo während des Lockdowns die Sitze aus Passagierflugzeugen raus. So konnte sie mehr Güter transportieren, mit welchen wir die Pandemie bekämpften.
Hätten Sie einen Kollaps des Systems für möglich gehalten?
Durchaus. Aus meiner Sicht war er vorprogrammiert. Nur schon weil eine Konsolidierung der Lieferanten und Lieferketten stattfand. Viele Unternehmen arbeiten nicht mit einer Mehrzahl von Lieferanten für alle wichtigen Ausgangsmaterialien. Wenn ich alles vom selben Lieferanten beziehe, habe ich einen besseren Preis. Das System war auf Kostenreduktion und Schnelligkeit ausgerichtet. Keine administrative Verschwendung, wenig oder keine Lagerhaltung. Sobald eine Perturbation – ein Störfaktor – eintritt, fällt die Lieferkette aus dem Gleichgewicht. Es gibt wenig Polster. Oder die Lager sind auf der anderen Seite der geschlossenen Grenze. Dieses Szenario wurde leider unterschätzt. Viele überlegen sich nun, wie ihre Lieferketten an Robustheit dazugewinnen können. Das sieht man daran, dass Hersteller sich überlegen, wie sie wieder lokaler produzieren können. Zum Beispiel ist Österreich nun bereit, Subventionen für die lokale Produktion von Antibiotika zu bezahlen.

Für viele kleine Unternehmen ist der Aufwand zu gross, einen zweiten Händler zu suchen.
Es ist sicher eine Kostenfrage. Der Aufbau und die Pflege der Beziehungen kosten. Es ist aufwändiger, wenn ich mehrere Stufen der Lieferkette manage und auch die Fragen stelle: Wer sind die Unterhändler, woher kommen die Rohstoffe? Aber das gehört zur Robustheit.
Glauben Sie, die Unternehmen werden diesen Weg gehen?
Gewisse Industrien haben sich damit auseinandergesetzt. Etwa im Pharmabereich, wobei dort die Margen auch entsprechend gross sind, die Unternehmen können es sich besser leisten. Für Firmen, die im tieferen Margenbereich arbeiten, ist es schwierig. Aber sie zeigen sich innovativ. Ich finde es beeindruckend, wie viele Schnapsbrenner das Geschäftsmodell angepasst haben und nun Desinfektionsmittel anbieten. Es riecht toll nach Kirsch (lacht). Das finde ich ein gutes Beispiel.
Der Metallbauer oder die Holzbauerin, sollten sie ihre Lieferkette besser verstehen?
Ich denke ja. Jeder sollte die Gelegenheit nutzen. Wie weit will ich in meiner Lieferkette zurückgehen? Welche Alternativen gibt es? Solchen Fragen sollten sie sich im Idealfall stellen.
Da geht es auch um den Nachhaltigkeitsaspekt. Glauben Sie, dies könnte sich längerfristig ändern?
Ich glaube, längerfristig nicht. Sobald der Störfaktor weg ist, strebt das System wieder das Lean Manufacturing an. Aus dem Fachjargon übersetzt heisst dies, dass im Produktionssystem möglichst viel Zeit (Verschwendung) gespart wird, indem unnötige Bewegungen oder Lagerhaltung vermieden werden. Es ist nicht per se eine schlechte Sache, weil so die Verschwendung reduziert wird. Lean heisst weniger Fett. Ich würde auch gerne mal ein paar Kilo verlieren. Aber wenn ich eine Erkrankung überstehen will, brauche ich diese Extrakilo.
Wie stark glauben Sie, wird die Lage von den Zwischenhändlern ausgenutzt, um höhere Preise zu verlangen?
Das ist eine schwierige Frage. Ich weiss es nicht. Ich weiss, dass es ausgenützt werden könnte. Dass die Knappheit zu höheren Preisen führt, ist logisch. Dass höhere Preise für gewisse attraktiv sind, ist auch logisch. Wo Geld zu verdienen oder Kundschaft zu gewinnen ist, besteht die Versuchung, dies auszunützen. Wissenschaftlich finde ich spannend, dass die Preise steigen, aber nicht unbedingt die Inflationsindexe. Zumindest noch nicht.
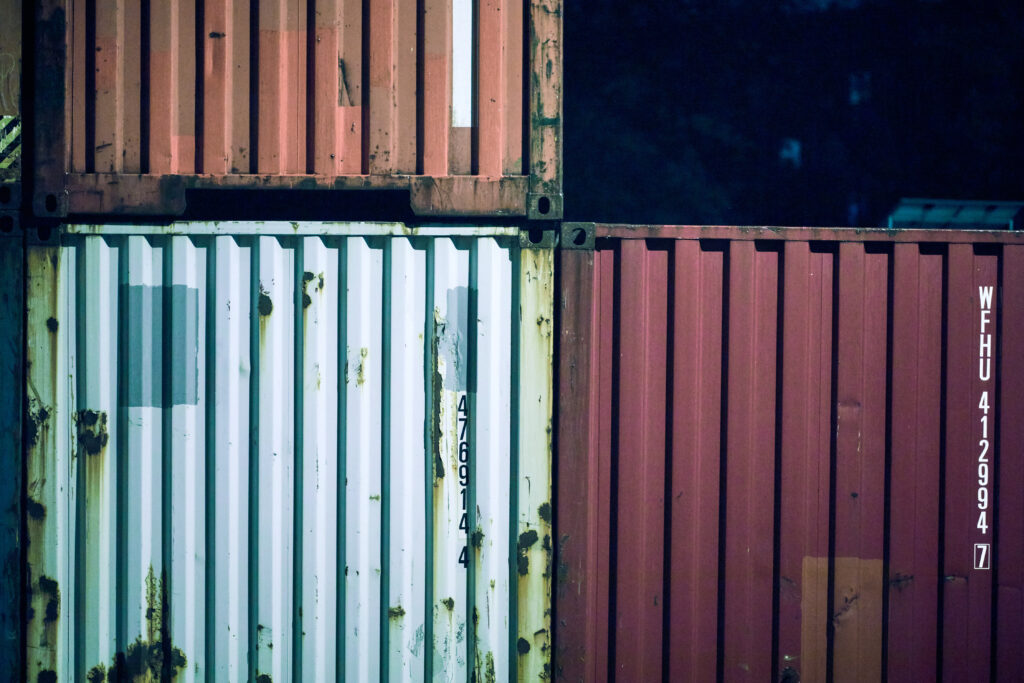
Was ist aus Ihrer Sicht das grösste Problem der aktuellen Knappheit?
Die grösste Herausforderung wird sein, die Lieferketten wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Wenn wir ans Trichtermodell denken: Bildlich gesprochen verschiebt sich der Flaschenhals an einen anderen Punkt. Etwa durch das Herdenverhalten. Das meistbekannte Beispiel sind die Hamsterkäufe von Toilettenpapier. Damit die Kette wieder «normal» wird, braucht es Vertrauen in die Systeme und Partner. Damit wir nicht Sachen horten. Ansonsten entstehen wellenartige Schwankungen, weil das System mit Überkompensation reagiert. Die Hersteller wissen nicht, ob sie noch mehr produzieren müssen oder nicht. In der Automobil- und Flugzeugbranche ist dies momentan die grosse Frage: Wie viel Kapazität sollen sie für die Zukunft aufbauen?
Was wirklich knapp ist und wo nur die Lieferketten stocken, lässt sich kaum abschätzen. Wie behalten die Firmen den Überblick?
Mit Transparenz und Vertrauen: Wenn ich weiss, dass das Toilettenpapier immer verfügbar sein wird, gehe ich zurück zu normal. Sonst bleibt es ein Blick in die Kristallkugel. Ob Mensch oder Firma, beide verhalten sich bei den Hamsterkäufen ähnlich.

Viele wollen vermutlich ihre Geheimnisse nicht preisgeben und Transparenz schaffen.
Das ist die asymmetrische Informationslage: «Ich weiss es, aber du nicht.» Firmen sollten in den sauren Apfel beissen und Transparenz schaffen. Sonst wird es sehr lange dauern, bis das System ins Gleichgewicht kommt. Hohe Transparenz bindet ausserdem Kundschaft.
Was raten Sie den lokalen, kleineren Betrieben?
Drei Dinge: Erstens in der Lieferkette ein paar Stufen nach vorne und nach hinten schauen. Herausfinden, woher die Ware kommt, welche Flexibilität die Lieferanten haben. Das zweite ist die geographische Überlegung: Suche ich vielleicht einen zweiten oder dritten Lieferanten in der Nähe? Einige gehen bereits diesen Weg. Der dritte Rat: Nachhaltiger, längerfristig denken und an Robustheit zulegen. Damit nicht so schnell wieder nur die sichtbaren Kosten und die Geschwindigkeit zählen, sondern die echten Kosten und der Gesamtaufwand.
Wie gehen die lokalen Betriebe mit der Situation um? Wir haben sie befragt.








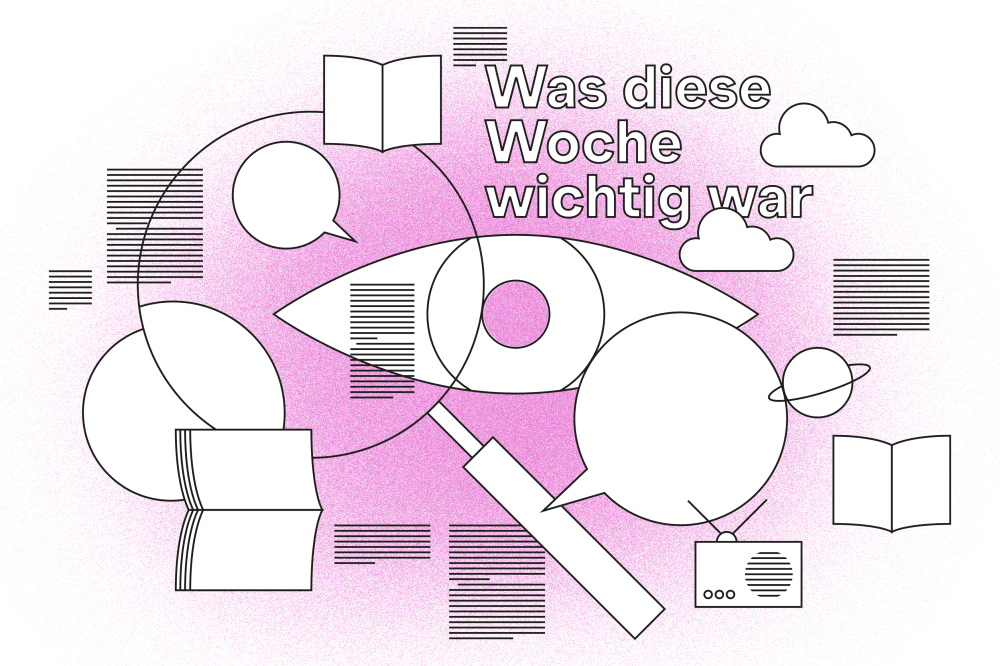


Bist auch du mit deinem Unternehmen betroffen? Erzähl uns deine Situation und wie du damit umgehst.