Wie stark drehen wir den Geldhahn auf?
Stundenlange Debatten und trotzdem bleiben die Meinungen festgefahren. Wenn das Oltner Parlament über die Stadtfinanzen diskutiert, ähneln sich die Voten in den letzten Jahren. Es ist ein Politdrama erster Güte. Das war auch dieses Jahr nicht anders. Wir erklären, warum es sich bei diesen zähen Debatten lohnt, über das kommende Jahr hinauszublicken. Und zeigen, was die Steuererhöhung fürs eigene Portemonnaie bedeutet.
Die Vorgeschichte: Wie Olten sich wieder fing
Der Schock war heftig: 2014 brachen die Steuereinnahmen des Stromriesen Alpiq komplett ein. Auf einen Schlag flossen 27 Millionen Franken weniger Unternehmenssteuern in die Oltner Kasse. Die Stadt zog ein rigoroses Sparprogramm auf. Trotzdem gabs zunächst rote Zahlen – die Kleinstadt musste sich verschulden. Die Trendwende gelang 2016. Damals belief sich die Pro-Kopf-Verschuldung auf 3’363 Franken. Der Stadt ist es gelungen, die Schuldenlast bis heute auf mehr als die Hälfte zu reduzieren. Möglich war dies, weil Olten die Ausgaben herunterfuhr und in den letzten Jahren nur zögerlich neue städtebauliche Projekte umsetzte. Seit 2013 investierte Olten durchschnittlich pro Jahr rund 9 Millionen Franken. Die Investitionen von vergleichbaren Städten – mit weniger als 30’000 Einwohnerinnen – belaufen sich im Durchschnitt jährlich auf rund 14.5 Millionen Franken.
Und nun? Die grossen Pläne
Was die Kleinstadt mit Zentrumsfunktion in den letzten Jahren vernachlässigte, möchte sie nun nachholen. Zumindest zeigt der politische Kompass in diese Richtung: Parlament und Stadtrat sind urban-progressiver geprägt denn je. Und somit ist auch der politische Drang, Neues zu gestalten, deutlich spürbar. Aber die Bürgerlichen drücken auf die Bremse: In den letzten Jahren nahmen sie sukzessive die Oppositionsrolle ein und waren mit dem Budgetreferendum 2019 erfolgreich. Das Seilziehen wird in den nächsten Jahren weitergehen. Im Zentrum immer die Frage: Was braucht Olten, um eine lebenswerte Stadt zu sein? Kultur, Begegnungsräume, intakte Infrastruktur fordert die Linke. Die Ausgaben einschränken und die Steuern nicht erhöhen, das wollen die Bürgerlichen.

Auf dem Tisch liegen wegweisende Projekte
Diese städtebaulichen Projekte haben Stadtrat und Parlament aufgegleist:
- Schulhaus Kleinholz mit Dreifachturnhalle: 40 Mio. Franken – Stimmvolks-Ja im Frühling 2021 (im Finanzplan mit 36 Mio. Franken ausgewiesen, da die ersten 4 Mio. Franken bereits dieses Jahr fliessen)
- Schulbauten Frohheim: 19 Mio. Franken (10 Mio. für einen Klassentrakt, 8.7 Mio. für den Erweiterungsbau)
- Kunstmuseum: brutto 14 Mio. Franken (2 Mio. sollten von Dritten zurückfliessen)
- Neuer Bahnhofplatz: 23 Mio. Franken (Investitionen bis 2028 – Bauprojekt geht darüber hinaus)
Die Stadt geht im Finanzplan davon aus, über die kommenden sieben Jahre insgesamt 127 Millionen Franken (durchschnittlich jährlich gut 18 Millionen Franken) zu investieren. Dabei gilt es zu beachten: Einen grossen Brocken (31 Prozent) machen die Investitionen in den Werterhalt aus – Gelder, welche die Stadt beispielsweise für den Strassen- und Gebäudeunterhalt benötigt. Möchte Olten darüber hinaus die oben genannten Projekte stemmen können, müssen die Steuern leicht erhöht werden. Dies hat der Stadtrat bekanntgegeben. Das letzte Wort wird bei den Grossprojekten jeweils die Stimmbevölkerung haben. Lehnt sie ein Grossprojekt ab, würden die Finanzen zwar entlastet, aber auch das Projekt verzögert – die Entwicklung der Stadt gehemmt.
Die Steuersituation
Bevor die Alpiq-Quellen versiegten, lebte Olten ohne finanzielle Sorgen. Wer in die Bücher blickt, sieht, dass die Stadt 2012 und 2013, also in den Jahren vor dem Kollaps, einen Steuerfuss von 95 Prozent hatte. Das erscheint im Vergleich zu heute fabulös. Als die Stadt auf den Boden der Realität zurückgekehrt war, hob sie den Steuerfuss in zwei Schritten auf 108 Prozent an. Seit 2015 blieb er unverändert – die Bürgerlichen wehrten die Absichten des Stadtrats, den Steuerfuss zu erhöhen, jeweils ab. Dieses Jahr ist die Debatte von neuem lanciert.
Fakt ist: Ohne Steuererhöhung wird die Stadt die Investitionen bremsen müssen. Denn die finanzielle Situation würde prekär werden. Olten müsste sich noch stärker verschulden, da die eigenen Gelder, um die kommenden Projekte selbst zu finanzieren, noch knapper wären. Die Pro-Kopf-Verschuldung stiege gemäss Prognosen auf rund 5000 Franken, der Nettoverschuldungsquotient auf knapp 150 Prozent – beides Grenzwerte, welche nach Gemeindegesetz zur Schuldenkontrolle durch den Kanton führt. Dabei wird der Handlungsspielraum eingeschränkt. Die Stadt könnte nicht mehr grosse Projekte umsetzen, weil sie diese zu 80 Prozent selbst finanzieren müsste – ein Ding der Unmöglichkeit.
Nettoverschuldungsquotient – was ist das?
Er gibt an, wie hoch die Verschuldung im Verhältnis zu den Steuererträgen von juristischen und natürlichen Personen bei einem Steuerfuss von 100 Prozent ist. Bei einem Nettoverschuldungsquotient von 150 Prozent müsste die Stadt demnach über 1.5 Jahre sämtliche Steuereinnahmen (berechnet auf Steuerfuss von 100 Prozent) beiseitelegen, um ihre Nettoschulden zu tilgen.
Steuerfuss 112 statt 108 Prozent: Was heisst das für mein Portemonnaie?
Solothurn zählt seit jeher nicht zu den steuerattraktiven Kantonen. Weil der Kanton dezentral organisiert ist, sind die Steuerfüsse in den Gemeinden ausserdem verhältnismässig hoch. Ein Beispiel: Im Kanton Baselland etwa gibt es nur ein Bauinspektorat (in Liestal) – in Solothurn ist dies eine Gemeindeangelegenheit.
Was aber bedeutet die vom Stadtrat geforderte Steuererhöhung für den einzelnen Haushalt? Eine wenig verdienende Einzelperson mit einem steuerbaren Einkommen von 29’000 Franken (nach allen Abzügen, bspw. Hypotheken, Zahlungen an die dritte Säule der Altersvorsorge) müsste bei einem Steuerfuss von 112 Prozent pro Jahr 50 Franken mehr an die Gemeinde bezahlen (insgesamt 1400 Franken). Bei einer Familie aus dem Mittelstand mit einem steuerbaren Einkommen von 100’000 Franken betrüge die Differenz 265 Franken (7433). Für eine Familie mit einem hohen Haushaltseinkommen und einem steuerbaren Einkommen von 210’000 Franken wären es 730 Franken (20’086).
Für Firmen würde sich die Steuererhöhung auf 112 Prozent marginal auswirken. Vor allem die grossen Unternehmen mit einem Gewinn von über 100’000 Franken profitierten von der letztes Jahr in Kraft getretenen Unternehmenssteuerreform, über die Kolt bereits vertieft berichtete. Im Jahr 2020 sinken gemäss Prognose die Steuereinnahmen von juristischen Personen der Stadt Olten um mehr als ein Drittel – von über 20 Millionen auf gut 12 Millionen Franken. Noch macht sich dies in der Kasse nicht in vollem Umfang bemerkbar, weil der Kanton bis 2027 Ausgleichszahlungen leistet.
Der unbestrittene Urnengang
Nach der Parlamentsdebatte hat sich die Ausgangslage nochmal verändert: Hauchdünn setzte sich erwartungsgemäss die Ratslinke mit ihrem Ansinnen durch. Dies nachdem die Bürgerlichen den Kompromissvorschlag der Linken, die Steuern sowohl für natürliche wie auch für juristische Personen auf 110 Prozent zu erhöhen, im Vorfeld abgelehnt hatten. Für die linken Parteien war der Kompromissvorschlag der Rechten, bei den Ausgaben zu sparen und den Steuerfuss wie gehabt zu belassen, ebenso keine Option. Olten jetzt!, die Grünen und SP / Junge SP zimmerten daraufhin einen eigenen Vorschlag: Ein Steuerfuss von 110 Prozent (+ 2 Prozent) für Privathaushalte – und 118 Prozent (+ 10 Prozent) für die Unternehmen. Das letzte Wort gibt das Parlament der Stimmbevölkerung: Im Februar kann sie über das Budget befinden. Somit verhinderte das Parlament das drohende Referendum.
Die Rechte drohte schon in der Debatte, dieses Budget werde an der Urne wie 2019 nicht mehrheitsfähig sein. Die Linke aber glaubt, dass die Ausgangslage nun anders ist. Sie wird argumentieren, das Ja zum Schulhaus Kleinholz legitimiere die leichte Steuererhöhung. Für sie wird es zur grossen Herausforderung, der Bevölkerung aufzuzeigen, dass die Steuererhöhung für die Unternehmen de facto keine ist. Von der Steuerreform profitierten vor allem jene Betriebe mit grossen Gewinnen. Kleine Unternehmen mit geringen Gewinnen spürten die Reform kaum – auch weil sie höhere Abgaben für die Altersvorsorge leisten müssen. Jedoch würde der um 10 Prozentpunkte erhöhte Steuerfuss sich kaum auf ihre Steuerabgaben auswirken.

Zahlen über Zahlen
Das Beispiel Olten zeigt: Für eine Kleinstadt, die sich entwickeln will, ist es schwierig, die finanzielle Balance zu finden. Aber der Fall der Alpiq hat deutlich gemacht, dass die Stadt sich bei grossen Rückschlägen rasch an eine neue Situation anpassen kann. Jene Zeiten, in welchen sich die Stadtkasse durch Firmensteuern alimentieren lässt, scheinen ohnehin weit weg: Die Unternehmenssteuern verlieren aufgrund der Steuerreform weiter an Gewicht. Mittelfristig müssen die Steuereinnahmen aus den Privathaushalten das Gerüst für eine gut aufgestellte Stadt bilden, die sich auch weiterentwickeln kann.
Unweigerlich kommt hier die Frage nach der Wohnattraktivität ins Spiel. Der Steuerfaktor bildet dabei nur einen Parameter und aufgrund der kantonal bedingt hohen Steuerlast wird Olten in der Schweiz nie im Konzert der steuerattraktiven Gemeinden mitspielen. Die Kleinstadt kann sich aber auf andere Stärken besinnen: Tiefe Mietpreise, die zentrale Lage und die vielfältige Kulturszene. Zur Frage, was nun Wohnattraktivität ausmacht, gibt’s keine richtige oder falsche Antwort. Das zeigen die divergierenden, vielzitierten Städterankings: Im Massstab der Handelszeitung landet Olten punkto Lebensqualität auf dem 462. Rang (von den 936 Gemeinden mit über 2000 Einwohnerinnen). Im Städteranking der Bilanz aber erreichte Olten dieses Jahr den 32. Rang (von 162 möglichen Rängen).
Wie wichtig ist die Steuerfrage für deine Wohnortswahl? Warum lebst du in Olten?
Schreiben Sie einen Kommentar Antworten abbrechen
Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.








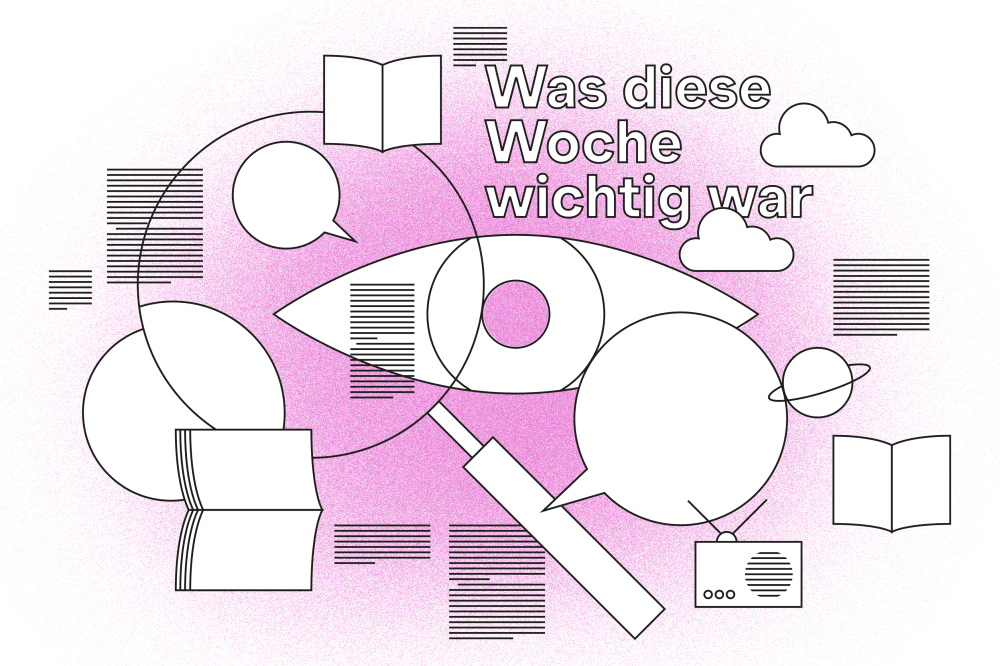


Danke Yann! Wunderbar erklärt! Genau das ist die Situation, in der wir uns befinden.
Merci, Herr Schlegel, für diesen Tour d’Horizon.
Wie schön es doch für Politiker sein muss, das Geld anderer Menschen freigebig zu sprechen – man steht dann im KOLT als grossmütige Förderer von “Kultur, Begegnungsräume[n], intakte[r] Infrastruktur” da. Als ob wir Bürgerlichen an diesen Trümpfen im Standortwettbewerb kein Interesse hätten. Aber wie viel tolle Kultur entsteht eigentlich in Olten ganz ohne Förderung, wie viele wertvolle Begegnungen finden in unserer Stadt ohne teure Aussenraumkonzepte statt und wer bestimmt eigentlich, wann die Infrastruktur intakt ist? Und wenn ein Projekt doch viel Geld kosten muss, wie es beispielsweise das Schulhaus Kleinholz völlig zu Recht tut, dann gilt es halt, Prioritäten zu setzen.
Olten wird im Steuerwettbewerb nie einen Schönheitspreis gewinnen, da haben Sie absolut recht. Aber darum geht es doch gar nicht. Vielmehr traue ich den Oltnerinnen und Oltnern zu, ihren Lohn selber so einzusetzen, wie es für sie und ihre Familien am besten passt – und nicht, wie im Stadthaus für sie entschieden wird.
Danke, dass Sie am politischen Ball bleiben!
Der Stadtrat sagt, Olten könne in den nächsten sieben Jahre total 127 Millionen Franken investieren. Damit würde zwar die Verschuldung pro Kopf von heute rund 1’400 Franken fast verdreifacht (trotz spürbarer Steuererhöhung), aber noch knapp unter dem Grenzwert bleiben, ab dem die kantonale Schuldenbremse zuschlägt (ab 5’000 Franken).
Was der Stadtrat nicht sagt: Seine Rechnung geht nur auf, weil er verschiedene grosse Projekte für die nächsten 7 Jahre in diese 127 Millionen gar nicht eingerechnet hat, z. B. die künftige Nutzung des Hübelischulhauses, das nach Eröffnung des neuen Schulhauses Kleinholz ab 2025 leer stehen wird. Oder die Zukunft der sanierungsbedürftigen Stadthalle, die es nach Realisierung der Dreifachturnhallen im Kleinholz ab 2025 in der heutigen Form nicht mehr braucht. Hübelischulhaus und Stadthalle werden jeweils Kosten in zweifacher Millionenhöhe auslösen. Diese Kosten sind ebenso wenig im Finanzplan eingerechnet wie die Kosten für Klimaschutzmassnahmen.
Die Stadt hat ein Ausgabenproblem und nicht ein Einnahmenproblem (im Jahr 2021 wird die Rechnung um 7 Millionen besser als budgetiert im tiefschwarzen Bereich abschliessen, auch weil die Steuereinnahmen munter sprudeln).
Es braucht eine klare Fokussierung der Investitionen auf Projekte, welche die Stadtentwicklung tatsächlich fördern! Mit Steuererhöhungen gewinnt Olten keine zusätzlichen Steuerzahlenden
Yann Schlegel stellt die Frage: “Was aber bedeutet die vom Stadtrat geforderte Steuererhöhung für den einzelnen Haushalt?” Was der Journalist in seiner Antwort vergisst zu sagen: Schon heute zahlt eine Mittelstandsfamilie mit zwei Kindern in Olten einige 1’000 Franken mehr Steuern als in umliegenden Städten.
Ein konkretes Beispiel für eine Familie mit zwei Kindern und einem Familieneinkommen von 100’000 Franken (Frau und Mann berufstätig). Laut dem Vergleichsdienst Comparis muss diese Familie in Olten jährlich 9’485 Franken Steuern zahlen.
Wie sieht die Steuerrechnung in Nachbarstädten aus?
In Aarau will das Steueramt von der Familie 6’563 Franken, Jahr für Jahr 2’922 Franken weniger als in Olten.
In Lenzburg sind es 2’671 Franken weniger.
In Zofingen spart die Familie 2’571 Franken, in Baden über 3’000 Franken.
Und auch Sursee (Einsparung 2’662 Franken) und Sissach (1’837 Franken) lassen Olten teuer aussehen.
Wie attraktiv ist für eine solche Familie der Umzug in Olten? Die Frage stellt sich nicht nur in Bezug auf die Steuern, sondern auch die gesamten Lebenskosten: Wohnungen und andere Kosten sind in Olten aktuell kaum mehr günstiger als in den Nachbarstädten (Studie der Credit Suisse von Oktober 2021). Unter dem Strich (Steuern und andere Kosten) bleiben in Olten weniger Franken zum Leben als in den Nachbarstädten.
Eine grosse Ausgabe fehlt da sogar noch. Die PU Hammer kostet die Stadt ebenfalls rund 20 Millionen, die sie notabene per Gesetz eigentlich zum Grossteil der Terrana AG verrechnen müsste. Nach §42 GBV gilt: «Die Gesamtheit der Grundeigentümer, deren Grundstücke durch den Neubau einer Strasse einen Mehrwert oder Sondervorteil erhalten, haben an die Erstellungskosten der Gemeinde folgende Beiträge zu bezahlen: a) für Erschliessungsstrassen und Fusswege 80 % der Kosten; […] Die Gemeinde kann diese Ansätze erhöhen.»
Die finanzielle Schlaumeierei der Stadt, die stattdessen noch mehr Wohnzone schaffen will in Olten Südwest, als da ohnehin schon besteht (ca. 150 leere Wohnungen und weitere Reserven für mehr als 1500 Wohnungen), könnte ganz scheitern vor Verwaltungs- oder Bundesgericht. Dann zahlt der Steuerzahler, wenn die Politik nicht korrigierend eingreift und wenigstens den Stadtrat dazu bringt, das obligatorische Referendum für Ausgaben über 4 Millionen Franken einzuhalten. Denn so viel ist klar: An der Urne wird die PU Hammer scheitern, wenn sie vollumfänglich mit öffentlichen Geldern finanziert wird (so wie nun vorgesehen).