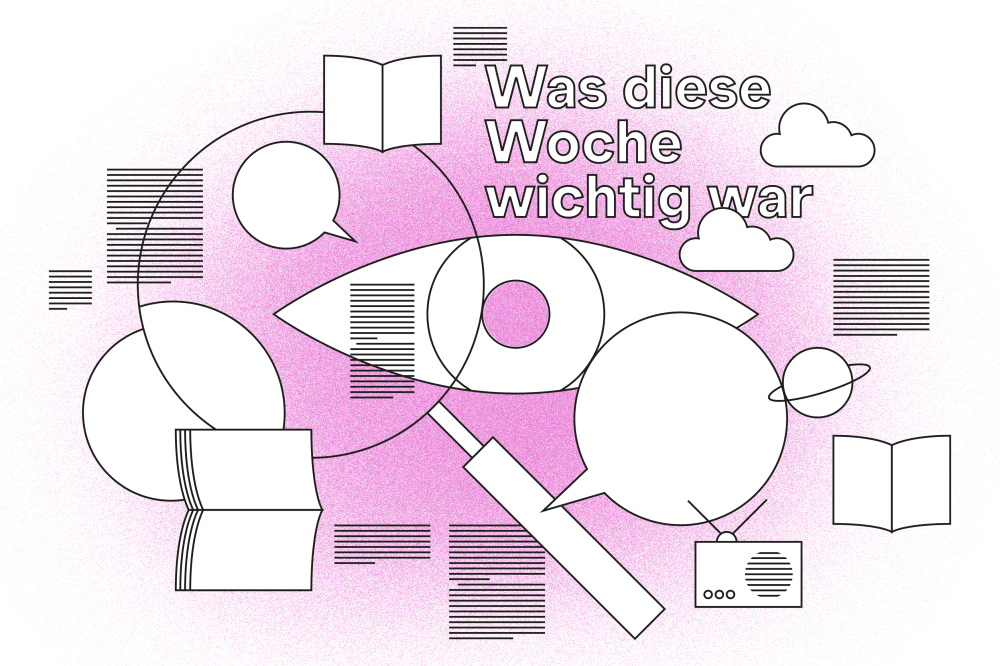«Es ist der ganze Lifestyle, der den Reiz ausmacht»
Stephan Künzli aus Olten flog ab 1983 als Linienpilot bei der Swissair, ab 95 als Captain. Am 11. September 2001 war er in Manhattan und sah zu, wie die Twin Towers brannten. Und wie die Türme zu Boden gingen und der Staub der Katastrophe aufstieg, da wusste er, dass dies der Todesstoss für die bereits arg angeschlagene Swissair sein sollte. Drei Wochen später ging die Swissair unter, aus der Crossair wurde die Swiss International Airlines, 400 Piloten wurden entlassen, nicht aber Stephan Künzli. Mittlerweile kommt er auf weit über 16’000 Flugstunden und fliegt die zwei grössten Flugzeuge der Swiss-Flotte, die beiden Airbusse A330 und A340 von Zürich nach Hongkong, San Francisco, Johannesburg, überall hin auf der Welt.
Sein Vater war Militärpilot während des 2. Weltkrieges. Simone, seine Frau, war früher Stewardess bei der Swissair. Sein Sohn Jonas fliegt Segelflugzeuge. Und seine beiden Töchter, die Zwillinge Meret und Laura, arbeiten wie er bei der Swiss, wie ihre Mutter früher als Flight Attendants. Vor kurzem haben die beiden ihr Studium begonnen, Laura und Meret arbeiten deshalb nun als Freelancer im Nebenjob, nachdem sie zuvor im 100%-Pensum um die Welt geflogen waren.
Das ist die Familie Künzli, wohnhaft im Schöngrund in Olten.
Wir haben Stephan und die Zwillinge Meret und Laura bei sich zu Hause getroffen. Ein Gespräch über betrunkene Passagiere, Wasserlandungen und Lieblingsdestinationen.
Stephan, Meret, Laura, wie muss man sich bei euch den Familientisch beim Abendessen vorstellen? Werden da nur Aviatiker-Witze gerissen und Anekdoten aus der Luft erzählt?
Meret: Nein, nein. Aber wir sprechen schon auch über die Arbeit. Und es gibt gute Geschichten zu erzählen, es passiert schliesslich Einiges in der Luft.
Stephan: Das Thema ist immer aktuell, allerdings nicht in erster Linie das Fliegen an sich, sondern die Umstände, wie etwa die unregelmässigen Arbeitszeiten. Das erfordert eine gewisse Organisation, darüber wird oft geredet. Dann war natürlich das Grounding ein Wahnsinnsthema, denn da ging es um die Existenz.
Ist Fliegen aber mehr als ein Job, eine Passion?
Laura: Passion würde ich es nicht nennen. Ich mache den Job sehr gerne, aber wenn es wirklich eine Passion wäre, hätte ich die 100%- Stelle nach 1 ½ Jahren wohl nicht aufgegeben, um mit dem Studium in Ethnologie zu beginnen.
Wieso hast du dich überhaupt für den Job als Flight Attendant entschieden?
Laura: Es war irgendwie schon immer klar, dass ich nach der Matura zur Swiss gehen würde.
Stephan: Ihr beiden habt ja schon als 3-Jährige Air Hostess gespielt…
Meret: …wir gingen oft mit unserem Vater auf Rotationen mit früher, und daher wusste ich schon immer, dass mir das sehr gefällt. Es ist ein toller Job, aber es ist nicht die Arbeit, die ich die nächsten 20 Jahre machen möchte. Es ist ja nicht die Arbeit an sich, die den Job so speziell macht…
…sondern das Land am Ende der Reise?
Meret: Ja, genau…
Stephan: …Es ist der ganze Lifestyle, der den speziellen Reiz dieser Arbeit ausmacht.
Ist vom Glamour der einstigen Fliegerhelden nicht Vieles verloren gegangen?
Stephan: Natürlich haben sich die Zeiten geändert. Mit dem Lifestyle meine ich eher, dass wir ständig irgendwo unterwegs sind und dass nie die Routine aufkommen kann, wie wenn man normal von Montag bis Freitag arbeitet.
Wie sieht denn eine „normale“ Woche bei dir aus?
Stephan: Als Beispiel: Ich bin am letzten Sonntag nach Tokio geflogen, ein 12-Stunden-Flug, und gestern (Mittwoch, die Red.) wieder heimgekehrt. Nach der Rückkehr habe ich vier Tag frei, und schon ist eine Woche um. In diesem Monat ist die Situation etwas speziell, weil ich auf Abruf arbeite. Ab Sonntag kann jederzeit ein Telefon kommen und dann bleibt mir gerade Zeit, um ins Auto zu steigen, nach Kloten zu fahren und 2 Stunden später bin ich wieder in der Luft in einem Langstreckenflugzeug, unterwegs nach irgendwohin.
Wieviel Zeit vor Ort bleibt den Flight Attendants normalerweise?
Meret: Weniger als früher. In New York etwa haben wir 24 Stunden.
Laura: In den meisten Städten hat man einen Aufenthalt von 24 Stunden vor dem Rückflug.
Da bleibt nicht allzu viel Zeit, schlafen muss man ja auch noch.
Laura: Mit gutem Time-Management kann man da schon das Optimum herausholen (lacht). Ich hab mich da nie abhalten lassen. Das ist schon ein grosser Anreiz an diesem Job.
Stephan: Wenn man als Pilot beginnt, gibt es diesen Anreiz natürlich noch nicht, weil es kaum Night-Stops gibt. Dann ist das Fliegen der Antrieb. Als Kurzstreckenpilot hast du pro Tag vier Flüge, vier Starts und vier Landungen, da kannst du dein Handwerk machen und üben.
Meret: Wir sind die ersten 9 Monate auch Kurzstrecke in Europa geflogen, bevor wir umgeschult wurden für die Langstrecke.
Stephan, wie viele Flüge machst du monatlich als Langstreckenpilot?
Etwa 5.
Ist man als Pilot nach so vielen Jahren noch fasziniert, wenn diese Riesenvögel in die Luft abheben?
Stephan: Ja, eine Faszination bleibt, es ist immer wieder lässig.
Kann man bei aller Alltäglichkeit, die das Fliegen für euch ist, noch nachvollziehen, wieso Menschen unter Flugangst leiden?
Laura: Ja, sicher. Das Hauptproblem ist der Kontrollverlust. Wir versuchen als Flight Attendants natürlich darauf einzugehen, wo möglich. Oft sind aber jene Passagiere, die uns über ihre Angst informieren, nicht diejenigen mit dem grössten Leiden.
Stephan: Auch für uns Piloten ist das ein zentrales Thema. Es gehört zu unserem Job, dem entgegenzuwirken, wobei die Mittel eingeschränkt sind. Das Mindeste ist, dass wir mittels Ansage ein Vertrauensklima schaffen. Meistens erzähle ich in der ersten Ansage vor dem Start schon von der Landung, damit die Passagiere, die Flugangst haben, das Gefühl erhalten, das Ende sei schon wieder absehbar. Piloten werden auch in der Kommunikation geschult, vor allem für sogenannte „abnormals“, also ungeplante Ereignisse, wie etwa technische Störungen. Es ist anspruchsvoll, in diesen Fällen richtig zu kommunizieren. Du musst bei der Wahrheit bleiben – was nicht heisst, dass du alles im Detail preisgeben musst – und gleichzeitig musst du dafür sorgen, dass die Passagiere das Vertrauen nicht verlieren.
Habt ihr denn schon solche “abnormals“ erlebt?
Stephan: Ich hatte noch nie einen technischen Notfall mit einem Flugzeug. Es gibt aber immer wieder Situationen, die wirklich sehr anspruchsvoll sind, vor allem wettermässig. Es gibt zum Beispiel beim Landeanflug offizielle Limiten, was die Windstärke angeht. Wenn nun aber zusätzlich die Landebahn noch nass ist oder Böen wehen, kann es auch kritisch werden, obwohl die Limiten noch nicht erreicht sind. Ausserplanmässige Landungen gab es in ein paar Fällen, etwa wegen medizinischen Problemen an Bord.
Meret: Ein grosses Problem können „unruly passengers“ sein, Passagiere, die Anweisungen nicht befolgen und aggressiv werden. Oft spielt da Alkohol eine Rolle.
Gibt es klare Anweisungen an die Flight Attendants, wie viel Alkohol ausgeschenkt werden darf ?
Laura: Nein, es gibt keine offiziellen Regeln. Wenn aber jemand offensichtlich viel zu viel getrunken hat, müssen wir ihm schonend beibringen, dass er nichts mehr kriegt. Ich bin aber relativ grosszügig (lacht).
Stephan: Der grösste Auslöser von Aggressionen ist die Flugangst, das ist ein Riesenproblem. Die Leute geben nicht zu, dass sie Angst haben, trinken vielleicht zu viel oder nehmen Medikamente und die daraus entstehende Aggressivität ist letztlich bloss eine Ausdrucksform der Angst.
Moderne Passagierjets lassen sich ja nicht mehr mit mechanischer Steuerung fliegen, alles ist mittlerweile elektronisch. Wieviel Macht darf ein Bordrechner über eine Maschine haben? Es häufen sich ja die Ereignisse, in denen eine austickende Elektronik zu massiven Problemen führt.
Stephan: Airbus hat ein an sich geniales System entwickelt, das die Steuerung eines Flugzeugs soweit einschränkt, dass etwa ein Abschmieren gar nicht mehr möglich ist, weil der Computer automatisch interveniert. Probleme entstehen aber dann, wenn dieser Computer falsche Messdaten erhält und fälschlicherweise interveniert. Wie das womöglich beim Absturz der Air France über dem Atlantik vor 2 Jahren der Fall war.
Die Auswertung der eben gefundenen Blackboxes wird hier hoffentlich Klarheit bringen.

Und der Pilot hat in solchen Fällen keine Möglichkeit, die Vollmacht vom Computer zurückzuerobern?
Stephan: In letzter Konsequenz ist das möglich, aber in dem Fall würde das Steuern eines Flugzeugs enorm schwierig. Auf Reiseflughöhe sind die modernen Jets enorm labil und bei heftigen Turbulenzen kann von Hand eigentlich gar nicht mehr geflogen werden – wenn dort oben alle Unterstützung auf einen Schlag wegfällt, kann schon der geringste Ausschlag zu viel sein. Bei älteren Flugzeugen wie der MD-11 konnte man theoretisch im Reiseflug mit aller Gewalt den Steuerknüppel voll nach hinten ziehen, worauf so viele g (Belastung durch Beschleunigung, die Red.) entstanden wären, dass es die Flügel einfach abgerissen hätte. Das ist heute nicht mehr möglich.
Wie ist die Leistung des Piloten Sullenberg einzuschätzen, der sein Flugzeug auf dem Hudson River in Manhatten notwassern musste und alle Passagiere gerettet wurden?
Stephan: Das war eine absolute Meisterleistung. Eine solche Wasserlandung gelingt aber auch dem besten Piloten der Welt nur mit enorm viel Glück. In 99 von 100 Fällen geht das schief, weil alles perfekt passen muss, damit es den Flieger beim Aufsetzen nicht zerreisst.
Was habt ihr am 2. Oktober 2001 gemacht, dem Tag des Swissair-Groundings?
Meret: Wir waren zusammen am Segeln in Italien.
Stephan: Die Folgen des Groundings habe ich erst später zu spüren gekriegt.
Was hat sich denn verändert, ausser dem Namen?
Stephan: Mit der Swissair habe ich mich viel mehr identifiziert, es war ein bestimmtes, spezielles Gefühl.
Laura: Also ich finde das Arbeitsklima bei der Swiss toll.
Meret: Geht mir genau so, wir haben immer eine tolle Stimmung in der Bordcrew.
Stephan: Man muss unterscheiden zwischen der Ambiance innerhalb der Crews, und die ist in der Tat toll, und auf der anderen Seite dem Geschäftsklima in der Gesamtfirma. Hier ist nach dem Untergang der Swissair etwas verlorengegangen. Immerhin kann die Swiss nach den ersten völlig missratenen Jahren unter André Dosé, dessen Führungsteam komplett inkompetent war, nun erfolgreich wirtschaften.
Und wie gross sind die Lohnunterschiede im Vergleich zu früher?
Stephan: Ich verdiene 30 Prozent weniger als zu Swissair-Zeiten.
Zurück zur Swiss der Gegenwart: Wohin fliegt ihr am liebsten?
Meret: Bangkok und Hongkong!
Laura: Das sind auch meine Lieblingsdestinationen, Bangkok und Hongkong.
Stephan: San Francisco oder LA zum Beispiel sind auch grandios, aber mir sind die Flüge in den fernen Osten ebenfalls lieber, einfach weil in diese Richtung die Zeitanpassung besser gelingt und man weniger erschöpft ist.
Schlussfrage: Ist es schon vorgekommen, dass ihr alle drei zusammen auf demselben Flug gearbeitet habt – ein Swiss-Flug als Künzli-Familienunternehmen quasi?
Meret: Ja, einmal. Das war nicht nur Zufall, wir haben das so eingegeben. So kam es, dass wir alle drei zusammen nach Hongkong geflogen sind. Laura und ich dagegen sind schon ein paar Mal zufälligerweise für denselben Flug eingeteilt worden.