Wo das Leben ausglüht
Die Abdankungshalle im Oltner Waldfriedhof Meisenhard ist menschenleer, der kahle Raum in Dämmerlicht getaucht. 320 Stühle stehen hier, säuberlich zu Reihen angeordnet, ein Rednerpult mit Mikrofon, ein Trauerkranz aus weissen Rosen. Sonst keine Bezugspunkte, nichts, woran der Blick hängen bleibt. Schnell schweift er über die karge Szenerie hinweg und fällt unwillkürlich durch die offene Verbindungstür in den angrenzenden Raum, auf den schwarzen Schlund des deckenhohen Verbrennungsofens.
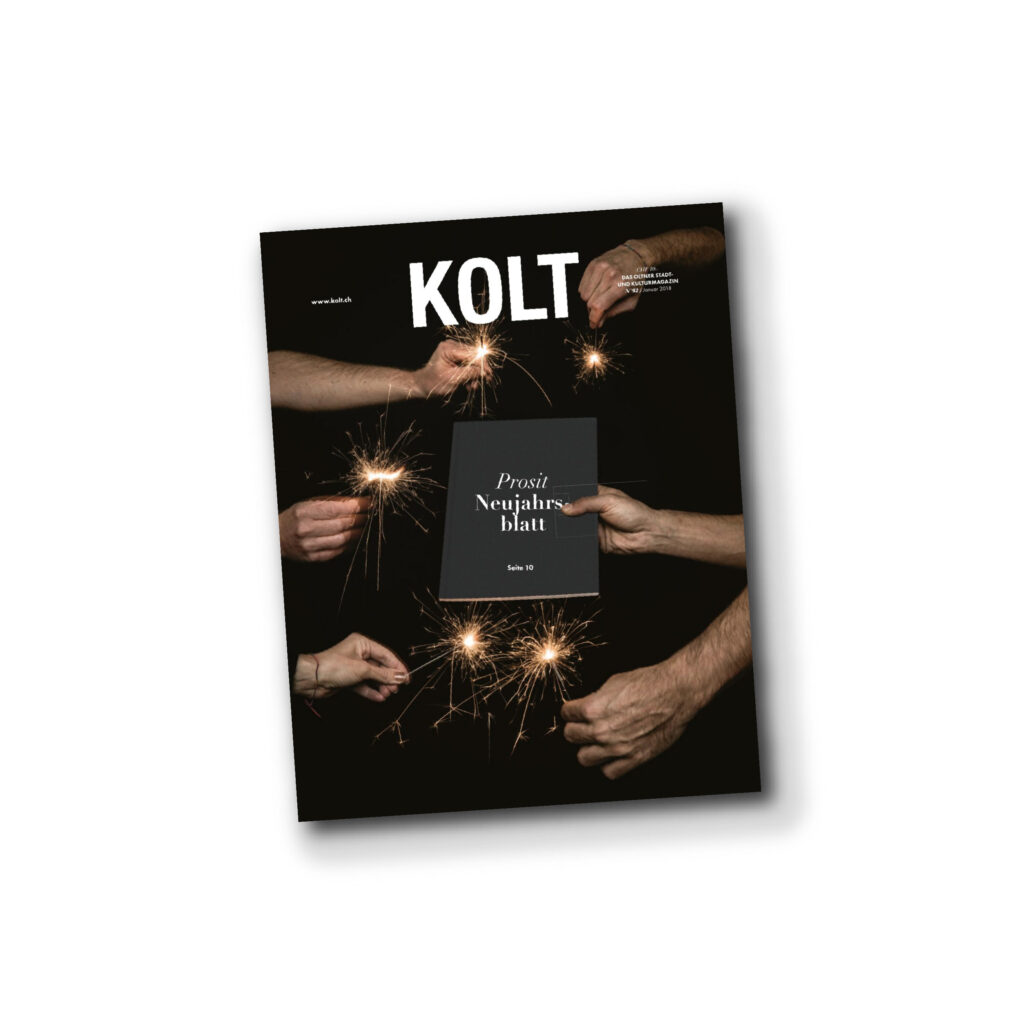
Es ist Donnerstagmorgen, halb zehn Uhr. Jetzt, im Winter, ist der Ofenraum angenehm warm. Im Sommer jedoch herrschen hier schweisstreibende 40 Grad. Die Temperatur des Ofens, der etwa drei Meter in der Länge und zwei in der Breite misst, fällt das ganze Jahr nie unter 650 Grad.
Peter Kempf macht das nichts aus. Der 56-Jährige, schlank, verheiratet, zwei Kinder, wohnhaft in Neuendorf, Wanderer, Skifahrer, Mitglied im Kirchenchor Neuendorf und im Jodlerklub Wolfwil, Vize-Präsident des Natur- und Vogelschutzvereins Neuendorf und Trainer der Korbballerinnen Neuendorf, ist seit sieben Jahren Feuerbestatter im Krematorium Meisenhard. Mit seiner unaufgeregten Art kann er es gut mit den Leuten, den toten wie den lebenden.

Auf einem Wägelchen hat er einen schlichten, unveredelten Holzsarg aus dem zwei Etagen tiefer liegenden Kühlraum geholt. Kempf platziert den Sarg auf der hochgefahrenen Einführschiene vor dem Ofen. Es wird heute Morgen die dritte Kremation sein. In der Steuerung gibt er die erforderlichen Daten ein: Name, Jahrgang und Wohnort der verstorbenen Person; war sie männlich oder weiblich, das Körpergewicht leicht, mittel oder schwer, der Sarg Standard oder lackiert? Oder handelt es sich um die monatliche Spitalkiste voller Körperteile?
Dem ausgedruckten Auftragsblatt entnimmt er, dass der Leichnam ein Mann war, Jahrgang 1937, aus einem Nachbarsdorf, normale Körpermasse. Kempf stösst das Wägelchen unter dem Sarg weg, fährt die Schiene auf Einfahrtshöhe herunter und drückt auf der Steuerung die Start-Taste. Das schwarze Ofentor fährt hoch. Hinter jedem Toten steht ein Termin.
Kempf und sein 27-jähriger Kollege Beda Wernli teilen sich die Arbeit im Krematorium. In der Regel beginnen sie ihre Arbeit um halb acht Uhr morgens. Bei maximal fünf Kremationen am Tag sind sie damit spätestens um halb drei Uhr nachmittags fertig. Jede Einäscherung wird vorgängig vom Bestatter im Oltner Bestattungsamt angemeldet und landet so direkt in ihrer digitalen Agenda. Denn ohne offiziellen Auftrag geht gar nichts. Nachdem der Bestatter den Sarg im Kühlraum deponiert hat, darf die verstorbene Person erst 48 Stunden nach ihrem Ableben kremiert oder erdbestattet werden. Die Angehörigen könnten eine Obduktion verlangen.
Die Einführschiene befördert den Sarg auf den dunkelorange glühenden Schamotterost im Ofeninnern. Er ist 700 Grad heiss, von den Seiten her wird Luft eingeblasen. Als sich das Ofentor schliesst, entzündet sich der Sarg sofort. Nach rund acht Minuten ist er zu Holzkohle zerfallen, der tote Körper trocknet nun aus und verbrennt. Die weisse Asche, die gar keine Asche ist, sondern Kalk und Knochenreste, fällt durch den Steinrost auf den Ofenboden.
Peter Kempf und Beda Wernli wechseln sich in ihren Aufgaben monateweise ab. Während einer drinnen den Ofen bedient, hat der andere im Büro oder draussen zu tun, bereitet Gräber für Beisetzungen vor, putzt Urnennischen heraus, schmückt die Abdankungshalle, geht nach der Abdankung mit der Urne voraus zum Ort der Beisetzung. Immer sind Angehörige in der Nähe. Hektik ist da fehl am Platz. Manchmal möchte die Familie der Kremation beiwohnen, dann arbeiten Kempf und Wernli zu zweit.

Man muss mit allem rechnen. Bei hinduistischen Kremationen drängten sich schon zwanzig Leute im Ofenraum: zu gefährlich. Heute dürfen höchstens vier Angehörige zugegen sein. Denn wenn das Tor offen steht, kann eine Hose in Ofennähe schnell Feuer fangen. Vom Feuerlöscher musste Kempf aber noch nie Gebrauch machen.
Die Einäscherung dauert eine Stunde. Durch das Guckloch hinten am Ofen ist wenig auszumachen. Ab und zu erhascht man einen flüchtigen Blick auf den geschwärzten Leib, aber meistens versperren die Flammen die Sicht. Hätte der Körper Übermass, 150 Kilo und mehr, würde er rund anderthalb Stunden brennen. Heutzutage sei das zunehmend der Fall, sagt Kempf. Die jeweilige Todesursache erfahren er und Kollege Wernli meist vom Bestatter. Viele Unglücksfälle haben sie, Personen, die vor den Zug oder in die Aare gesprungen sind. Die Kantonspolizei hat im Krematorium einen behelfsmässig eingerichteten Raum, wo sie die Toten identifiziert und dann an die Gerichtsmedizin weiterschickt.
Die meisten der Toten aber starben an Krebs, durchschnittliches Todesalter: zwischen 50 und 65 Jahren. «Das fällt beim Brennen auf», sagt Kempf. Bis zu zwei Stunden kann die Kremation eines Krebstoten dauern. Der Körper ist im Ofen dann gut erkennbar. Die vielen Medikamente, sie brennen schlecht.
Dass Peter Kempf heute Feuerbestatter ist, hat sich so ergeben. Eine eigentliche Ausbildung zum Feuerbestatter gibt es nicht, der Schweizerische Verband für Feuerbestattung gibt jedoch Regeln vor. Bis vor sieben Jahren leitete Kempf die SBB-Schreinerei in Olten. Er habe sich nicht mal viel dabei gedacht, als er sich auf die ausgeschriebene Stelle beim Oltner Werkhof meldete, sagt er. Mit dem Alter wollte er es beruflich etwas ruhiger angehen. Dass er den Tod nicht fürchtet, weiss er seit der Schreinerlehre. 1978 streifte er einem Verstorbenen im Spital Niederbipp zum ersten Mal das zu der Zeit übliche Totenhemd über. Damals erledigte das Einsargen noch der Schreiner.
Kempf betätigt in der Steuerung die «Reinigen»-Taste. Die Ofentüre schiebt sich nach oben, die Schamottesteine werden durch einen Luftstrom abgesaugt. Ein Hüftknochen ist auf dem Steinrost liegengeblieben. Kempf wischt ihn mit einem langstieligen Besen hinab. Dann begibt er sich einen Stock in die Tiefe, zum unteren Boden des Ofens. Darin glimmt im hinteren Teil die frische Asche. Vorne, unter dem Dach, liegt die ausgeglühte Asche von der vorherigen Kremation. Kempf kehrt sie in den Auskühleimer. Knochenstücke, Sargnägel, eine Hüftprothese aus Titan. Die Asche aus dem hinteren Ofenende fegt er nun nach vorne, unter das Dach.

«Wenn du nichts sehen willst, dann siehst du auch nichts», hatte Peter Kempf gesagt. Der Tod ist im Krematorium unsichtbar, geräusch- und geruchlos. Zwar ist es Kempf schon passiert, dass er die Asche zu früh herausholte. Er hatte den schwelenden Klumpen darin übersehen, wohl eine Leber oder eine Niere. Der Gestank von verbranntem Fleisch stach ihm in die Nase. «Äusserst unangenehm», sagt Kempf. «Aber das passiert dir nur einmal.»
Tatsächlich trifft man im Krematorium nicht den Tod an, sondern, was vom Leben übriggeblieben ist. Wenn die Asche nach einer Stunde ausgekühlt ist, werden die Knochenteile in der schrankgrossen Knochenmühle zu feinem Staub zermahlen und danach in eine Urne geschüttet. Das Metall wandert in zwei grüne Plastiktonnen. Die eine quillt vor Sargnägeln über, die andere ist mit Implantaten gefüllt. Heute, sagt Kempf, sterbe fast keiner mehr ohne. Er greift in die Tonne und hält eine künstliches Kniegelenk in die Luft: «Alte Machart, das ist noch ganz aus Titan», sagt er mit Kennerblick. Er lässt es wieder in den Kübel fallen und fischt eine moderne Hüftprothese mit Keramikkopf heraus. Eine Recyclingfirma holt das Material regelmässig ab.
Das Krematorium auf dem Friedhof Meisenhard ist seit 1918 in Betrieb. Die erste Kremation fand am 1. August statt, aber es blieb die einzige in jenem Jahr. Wer eingeäschert werden wollte, musste Mitglied des Feuerbestattervereins sein. Als 1963 die katholische Kirche das Feuerbestattungsverbot aufhob, nahm die Zahl der Kremationen rasch zu. Peter Kempf und Beda Wernli führen heute rund tausend Kremationen im Jahr durch. Bestatter bringen Leichname aus den Gebieten Olten, Niedergösgen, Oensingen, Attisholz, Sissach, Egerkingen, Safenwil und sogar Basel Stadt zu ihnen. Denn die Bevölkerungszahl steigt, jene der Krematorien aber nicht. Die Dreitannenstadt verzeichnet pro Jahr durchschnittlich 150 Todesfälle und lediglich vierzehn Erdbestattungen.
Interessant zu wissen: Der Friedhof Meisenhard verfügt über ein Grabfeld für muslimische Gläubige da diese ihre Verstorbenen nicht kremieren. Bei hinduistischen Ritualen entfacht oft das jüngste Familienmitglied des Verstorbenen das Feuer. Entsprechend drückt es im Krematorium am Ofen die StartTaste. Das Verstreuen der Asche in der Natur ist in der Schweiz erlaubt, in zahlreichen anderen Ländern aber untersagt. Und: Von einer einzigen Feuerbestattung bleibt in der Filteranlage ein Einmachglas voll mit dunklem, giftigen Feinstaub hängen. Sondermüll.
In einem Nebenraum reihen sich an der Wand sechs Kübel mit Asche, jeder fasst schätzungsweise zwanzig Liter. Sind zehn dieser Kübel voll, wird der gesammelte Knochenstaub im Gemeinschaftsgrab beigesetzt. Er verschwindet dann in einem grossen Tank im Boden, abgedeckt durch eine Steinplatte. Das Gemeinschaftsgrab ist die günstigste Art der Bestattung und wird häufig für Verstorbene gewählt, die über wenig Geld und keine Angehörigen verfügten. Die Gemeinde zahlt.

Auf Regalen stapeln sich in Kartonschachteln die offiziellen Urnen der Stadt Olten. Sie sind aus Stahl, Farbe altkupfer patiniert, Höhe 45 Zentimeter, Volumen vier Liter, Preis 32 Franken. Auch eine biologisch abbaubare Bio-Urne ist erhältlich. Edlere und individuellere Modelle hat der Bestatter im Sortiment. Kempf holt aus einem Schrank ein wuchtiges grünes Tongefäss hervor. Die alte Oltner Stadturne mit Drei-Tannen-Relief ist voluminöser als der heutige Standard – die Asche wurde früher nicht gemahlen. Dann packt Kempf eine winzige, 12 Zentimeter hohe Stahlurne aus. «Wir haben ziemlich viele Totgeburten», bemerkt er. Eine etwas grössere Urne, für Kinder im Alter von etwa 12 Jahren, habe er zum Glück erst einmal gebraucht.
Wenn man den ganzen Tag lang von Toten umgeben ist, dann macht das etwas mit einem. «Der Tod gehört halt zum Leben», sagt Kempf. Früher, da habe er sich jeweils viel schneller aufgeregt. Heute könne er auch mal fünf gerade sein lassen. Die Trauernden sind ihm dankbar für die Ruhe und Gelassenheit, die er ausstrahlt. Ältere Leute kommen manchmal extra für einen Schwatz auf den Friedhof. Für Peter Kempf ist das selbstverständlich, das gehört zum Beruf dazu. Regelmässig finden deshalb Dankeskärtchen und Selbstgebackenes den Weg in das Büro der Feuerbestatter.
Wenn Kempf Verwandte oder einen Jahrgänger kremiert, lüpft er kurz den Sargdeckel und verabschiedet sich. «Dass du das kannst», meinte sein Umfeld bewundernd, als er seine eigene Mutter den Flammen übergab. Aber in seinen Augen war es das Letzte, was er für sie tun konnte. Wenn Leute die Vermutung äussern, dass er einen traurigen Beruf habe, lädt er sie ein, einmal im Krematorium vorbeizuschauen. Er liebt seine Arbeit, beruflich möchte er nichts anderes mehr machen. Aber abends, wenn er nach Hause fährt, lässt er das Geschehen des Tages im Krematorium zurück. «Das ist wichtig», sagt er mit Nachdruck. Weil er weiss, wie er mit dem Tod umgehen muss. Und – nicht unwesentlich – wie mit dem Leben.















